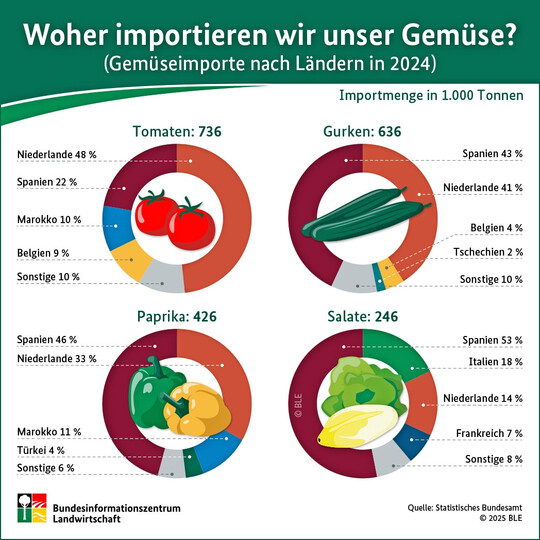Klimawandel erfordert Anpassungen im Wassermanagement
Wie die verschiedensten Klimamodelle zeigen, ist der Trend zu einem wärmeren Klima in den Gemüseanbauregionen der Bundesrepublik Deutschland ungebrochen.
- Veröffentlicht am
Folgende Veränderungen werden für den Zeitraum 2021 bis 2050 erwartet: Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur um circa 1°C, sehr deutliche Erhöhung der Anzahl der Hitzetage über 30°C, deutliche Abnahme der Niederschläge in den Sommermonaten und Zunahme der Niederschläge in den Wintermonaten (häufiger in wässriger Phase und nicht als Schnee) sowie über die Jahresperiode hinweg Zunahme an Starkniederschlagsereignissen und als Folge davon deutlich mehr Oberflächenabfluss. Bevorstehen können auch Schäden durch Bodenerosion und Überschwemmung, Zunahme der potenziellen Evapotranspirationsrate [ET0] um circa 10%, Zunahme der Variabilität der mikroklimatischen Bedingungen sowie zunehmende Beanspruchung der Puffersysteme in Boden und Pflanze.
Dies wird auch im Freilandgemüsebau nicht ohne Auswirkungen bleiben und es ist dringend erforderlich, die Bewirtschaftungssysteme an die bevorstehenden Bedingungen anzupassen. Freilandgemüsebau in der Bundesrepublik Deutschland ist ohne zusätzliche Wassergaben über Bewässerung nahezu unmöglich. Derzeit bedarf es hierfür je nach Betriebsstandort und Gemüsekultur zwischen 50 l/m² und 250 l/m² zusätzliches Wasser zu den natürlichen Niederschlägen. Dieser zusätzliche Wasserbedarf wird sich durch die aufgrund des Klimawandels steigende potenzielle Evapotranspirationsrate [ET0] bis ins Jahr 2040 nochmals steigern. Bereits heute gibt es in vielen Gemüsebauregionen intensive Diskussionen bezüglich der Nutzung von Wasser aus Brunnenanlagen. Eine Ausweitung dieser Nutzung wird sehr häufig kritisch betrachtet. Mal eben den nächsten Brunnen bohren und die Bewässerungsmenge ausweiten, so einfach wird es in Zukunft sicherlich nicht mehr gehen. Es wird in den nächsten Jahren darauf ankommen, regionale standortbezogene Bewässerungs- und Wassernutzungskonzepte zu entwickeln.
Im Bundesland Bayern gibt es über das „Pilotförderprogramm landwirtschaftliche Bewässerung“ bereits einige Initiativen. Ziel muss sein, möglichst kleine, regional stärker geschlossene Wasserkreisläufe zu etablieren. Ein wesentlicher Konzeptbestandteil sollte auch der Grund-/Trinkwasser- und Hochwasserschutz sein, um auch für die Gesellschaft einen Nutzen zu erreichen. Dann ist auch ein deutliches finanzielles staatliches Engagement für den Aufbau von solchen nachhaltigen Bewirtschaftungsstrukturen gerechtfertigt. Notwendig ist eine staatliche Förderung allemal! Neben der Erschließung neuer Wasserquellen für Bewässerungszwecke (Oberflächenabfluss, Brauchwassernutzung etc.) wird auch die ökologische Intensivierung der Anbausysteme mit Blick auf die Erhaltung und Förderung des Bodengefüges eine herausragende Rolle spielen. Der Boden ist der günstigste Wasserspeicher, der den Gemüsebaubetrieben zur Verfügung steht. Doch die derzeit oft einseitig technisch intensivierte, auf kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Ertrag ausgelegte Bewirtschaftung beansprucht den Boden sehr intensiv und die Böden weisen oft deutliche Strukturschäden auf.
Im Zentrum eines nachhaltigen Bewässerungs- und Wassernutzungskonzepts wird es darum gehen, die Bodenpflege wieder ins Zentrum gartenbaulichen Schaffens zu rücken. Dies bedeutet konservierende Bodenbearbeitung, Reduzierung/Verzicht auf den Einsatz von Mineraldünger, Einsatz von Kompost und anderen organisch stabilen Handelsdüngern zur Humusförderung und Förderung/Ernährung der mikrobiologischen Bodenkomponenten.
Ebenfalls mit Blick auf die Vermeidung negativer Einflüsse auf die Bodenmikrobiologie sollte auf den Einsatz von Fungiziden und Herbiziden verzichtet oder deren Einsatz deutlich reduziert werden. Um das Bodengefüge zu verbessern, sind ein noch intensiverer Zwischenfruchtanbau und/oder Mischkultur zur Auflösung der „Wurzel-Monokultur“ anzustreben. Hier gilt es auch die Möglichkeiten von Betriebskooperationen zu durchdenken. Und nicht zuletzt gilt es mehr bodenschonende Bewässerungsverfahren in der Praxis einzusetzen. Technische Möglichkeiten (Tropfbewässerung, Düsenwagen mit Schleppschlauch, u. a.) hierfür sind inzwischen entwickelt. Die Praxis sollte sie nutzen.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen