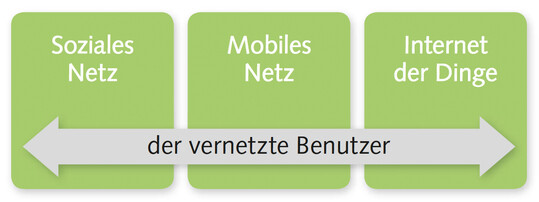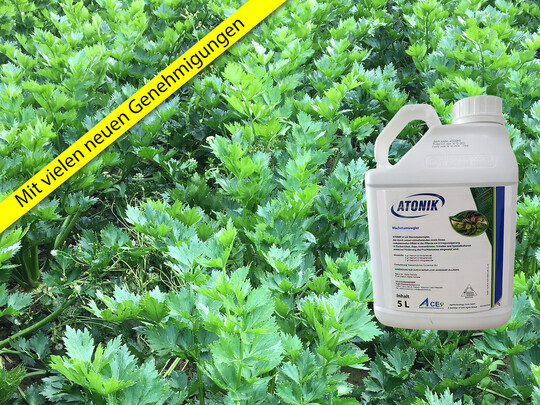Arbeitswirtschaft im Gemüsebau, Teil XI
„Nur die Guten ins Töpfchen...“
Mit der Jahreszeit und den Kundenwünschen ändern sich die
Ansprüche an die Qualität des geernteten Gemüses. Wie wird
sichergestellt, dass die Mitarbeiter dies verinnerlichen, das
Richtige tun und nur die gute Qualität „ins Töpfchen packen“.
- Veröffentlicht am

Als eines der obersten Gebote im Gemüsebaubetrieb zählt es, innerhalb einer Lieferpartie eine gleichmäßige Qualität sicherzustellen. Je nach Kulturzustand und -sätzen kann es notwendig sein, nahezu täglich eine Qualitätsschulung anzusetzen, um alle Mitarbeiter auf den gleichen Wissensstand zu bringen.
Das vermeintlich Schönste ist nicht immer das Beste
Aus einem idealen Pflanzenbestand heraus arbeitet es sich am einfachsten, doch dies ist in der Praxis leider nicht immer gegeben. Für eine Einzelperson ist es schon schwierig genug, gleichmäßige Ware aus einem Bestand herauszusuchen. Noch aufwändiger wird es, wenn mehrere Mitarbeiter für denselben Kunden ernten oder packen sollen.
Ungeübte Arbeiter neigen dazu, auf dem Feld sozusagen „einkaufen“ zu gehen. Sie suchen sich erst den schönsten Salatkopf aus, dann den zweitschönsten und so fort. Dieses vergleichende Heraussuchen dauert zum einen viel zu lange und zum anderen ist es wahrscheinlich, dass diese augenscheinliche Super-Qualität nicht in ausreichender Menge für die gesamte Lieferung zur Verfügung steht.
Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt entsteht dadurch, dass die Kunden an eine zu hohe Qualität für einen bestimmten Preis gewöhnt werden. Klare Qualitätskriterien beugen dem vor.
Eindeutige Kriterien zur Festlegung der Qualität schaffen
Die lieferbare Qualität des geernteten Gemüses hängt von den Kundenwünschen und vom aktuellen Zustand eines Pflanzenbestands ab. Vor dem Erntebeginn wird festgelegt, welche Kriterien für welchen Kunden gelten sollen. Dazu ist es notwendig, den aktuellen Bestand zu kennen oder sich zumindest telefonisch mit dem Gruppenleiter vor Ort abzusprechen, damit die bestellten Liefermengen zu erreichen sind.
Der Tipp: Einige Fotos mit dem Handy (geschickt per MMS) liefern schnell eindeutige Informationen und können langwierige Diskussionen ersparen.
Eindeutige Qualität bedeutet nicht einzigartige Qualität
Da Pflanzen eben keine Zündkerzen oder Schrauben sind, findet sich nie die einzig richtige Größe, das einzig richtige Gewicht, auch wenn diese Idealausgabe in der Qualitätsbeschreibung abgebildet ist. Der Optimalwert interessiert in der Praxis nicht. Gesucht ist die zulässige Spanne (siehe Abbildung 1). Aus diesem Grund müssen den Arbeitskräften Maximal- und Minimalwerte kommuniziert werden.
Idealerweise geschieht dies als real greifbares Beispiel, indem zum Beispiel an den Rand des Beetes zwei Töpfe mit Schnittlauch gestellt werden. Gesucht und gerichtet wird so: Nicht kleiner als im linken Topf und nicht größer als im rechten Topf.
Der Vergleich hinkt, Stichproben sind deshalb unerlässlich
Beim Richten oder Ernten der Ware dürfen keine Vergleiche innerhalb des vorliegenden Bestands angestellt werden. Gültig ist die objektive Qualitätsnorm der Vorgabe.
Der Effekt ist nur zu bekannt: In einem Feld oder einem Gewächshaus mit sehr gutem Bestand, wachsen verhältnismäßig große Früchte, und so erscheint einem die ausreichende Lieferqualität plötzlich klein und schmächtig. Tendenziell wird durch diese Sichtweise Gemüse in einem zu großen Wachstumsstadium geerntet. Steht man in einem Bestand mit relativ kleinen Früchten, kommt es zum umgekehrten Effekt.
Stichprobenvergleiche, wie das Wiegen der Gurke in Abbildung 2, sind unerlässlich.
Zur Objektivierung in der Praxis körpereigene Maße nutzen
Messschablone und Metermaß sind – arbeitswirtschaftlich gesehen – bei der Ernte unpraktische Hilfsmittel. Sie zwingen zu zusätzlichen zeitraubenden Vorgängen. Zur Überprüfung einer Größe bieten sich daher körpereigene Maße oder Maße am verwendeten Werkzeug (Schere, Messer) viel besser an.
Diese Werkzeuge sind nah am Produkt und sollten so gewählt werden, dass mit dem Erntevorgang automatisch die Überprüfung der Größe stattfindet.
Beim Schneiden von Grünspargel zum Beispiel hilft eine Markierung am Unterarm. Beim Ansetzen des Messers am Grund des Spargels sieht der Erntearbeiter sofort, ob die gewünschte Länge erreicht wird.
Gewichte austarieren und die Sache mit der Digitalwaage
In teureren Preisklassen wie zum Beispiel bei Zucchini oder Chicorée bedeutet jedes verkaufte Gramm Gemüse bares Geld. Dort besteht das Bestreben, das Zielgewicht möglichst exakt zu erreichen.
Beim Auswiegen beginnt ein Tauschen und Testen auf der Waage, um die Idealkombination zusammenzustellen. Der erste Tipp hierbei besteht darin, das Schätzen der Gewichte aktiv zu üben. „Wenn 50 g fehlen, wie würden Sie austauschen?“ Ein anderes Handicap besteht in der Erfassung der Gewichtsdifferenz. Viele Aushilfskräfte haben Schwierigkeiten den Gewichtsunterschied bei Digitalwaagen auszurechnen (siehe Abbildung 3). Eine Analogwaage mit Zeiger auf der Skala, zeigt sichtbar, ob viel oder wenig Abweichung zum Idealgewicht besteht. Eine rotgrüne Farbmarkierung verdeutlicht Unteroder Übergewicht.
Einüben, Gewichte zu schätzen und Stichproben durchführen
Es sollen Kohlköpfe zu einem Kilogramm herausgesucht werden. Die Platzierung eines „Modell-Kohlkopfes“ hilft den Arbeitskräften bei dieser Aufgabe weiter.
Am Anfang wird noch jeder Kopf zur Probe gewogen. Nach einer Einübungsphase, gibt es viele Mitarbeiter, die auf Anhieb die richtigen Köpfe aus der Großkiste greifen, und bei denen das Wiegen nur noch stichprobenartig notwendig ist. Ähnliches gilt, wenn Produkte in Schalen abgepackt werden sollen. Durch den Füllgrad der Schale und das Gewicht in der Hand entwickelt sich bald ein sicheres Gefühl für die notwendige Menge.
Selbstverständlich dürfen keine Untergewichte entstehen. Bei Schätzverfahren wird Übergewicht verkauft, aber der zeitund kostenaufwändige Wiegevorgang findet bei Niedrig-Preis-Produkten nur in Stichproben oder am Schluss auf der Verpackungslinie statt.
Mit Köpfchen zum „Ja – Ernte“ oder „Nein – bleibt stehen“
Wird zum Beispiel ein Salatfeld abgeerntet, ist der Pflanzenbestand Reihe für Reihe und Kopf für Kopf vor dem Schnitt zu beurteilen. Kontrolliert wird systematisch in Schlangenlinien entlang der Pflanzreihen. Jede Prüfung wird nur ein einziges Mal durchgeführt. Entweder es folgt ein „Ja“ und der Kopf wird geschnitten oder es kommt zu einem „Nein“. Dann bleibt der Kopf stehen.
Es gibt auf jeden Fall kein „Vielleicht“. Es hilft auch nichts, einen Kohlkopf stehen zu lassen und eine Minute später noch einmal in Augenschein zu nehmen. Ein rigoroses Vorgehen fällt vielen Menschen schwer. Bei der Einweisung wurde meist nur geübt, wie der Kopf geschnitten wird. Die dem Schnitt vorangehende Entscheidungsfindung „welchen Kopf schneide ich“ führt zu Zögern und Zeiteinbußen und muss daher auch „trainiert werden“.
Top oder Flop: Spielerisch zur Entscheidungsfindung
Um Routine für eine schnelle und richtige Entscheidungsfindung zu entwickeln, empfiehlt sich folgendes „Spiel“:
> Der Gruppenleiter stellt sich in eine kleine Runde von Mitarbeitern und bespricht anstehende Qualitätsvorgaben.
> Eindeutige „Fälle“ werden hochgehoben und herumgegeben, sodass jeder sprichwörtlich „Qualität begreifen“ kann.
> Nun hält der Gruppenleiter ein weiteres Beispiel von einem Produkt hoch.
> Alle Personen zeigen mit geschlossenen Augen mit dem Daumen nach unten ein „Nein“ oder mit dem Daumen nach oben ein „Ja“. So wird niemand vor der Gruppe blamiert, trotzdem sind die Einzelentscheidungen abprüfbar. Bei Fehlentscheidungen werden die zutreffenden Kriterien im Detail verdeutlicht.
> Die Schwierigkeitsgrade steigen. Zu guter Letzt nimmt man Grenzfälle, für die ein „Ja“ und ein „Nein“ akzeptabel wäre (Abbildung 4a und 4b).
Mit Humor und guter Laune durchgeführt, stärkt man auf diese Weise spielerisch die Sicherheit in der Runde und zeigt dem Vorarbeiter, bei welcher Arbeitskraft er noch einmal vorbeischauen sollte.
In »Gemüse« Nr. 8/2012 wird die Effizienz bei der Tomatenernte im Gewächshaus durchleuchtet.
Das vermeintlich Schönste ist nicht immer das Beste
Aus einem idealen Pflanzenbestand heraus arbeitet es sich am einfachsten, doch dies ist in der Praxis leider nicht immer gegeben. Für eine Einzelperson ist es schon schwierig genug, gleichmäßige Ware aus einem Bestand herauszusuchen. Noch aufwändiger wird es, wenn mehrere Mitarbeiter für denselben Kunden ernten oder packen sollen.
Ungeübte Arbeiter neigen dazu, auf dem Feld sozusagen „einkaufen“ zu gehen. Sie suchen sich erst den schönsten Salatkopf aus, dann den zweitschönsten und so fort. Dieses vergleichende Heraussuchen dauert zum einen viel zu lange und zum anderen ist es wahrscheinlich, dass diese augenscheinliche Super-Qualität nicht in ausreichender Menge für die gesamte Lieferung zur Verfügung steht.
Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt entsteht dadurch, dass die Kunden an eine zu hohe Qualität für einen bestimmten Preis gewöhnt werden. Klare Qualitätskriterien beugen dem vor.
Eindeutige Kriterien zur Festlegung der Qualität schaffen
Die lieferbare Qualität des geernteten Gemüses hängt von den Kundenwünschen und vom aktuellen Zustand eines Pflanzenbestands ab. Vor dem Erntebeginn wird festgelegt, welche Kriterien für welchen Kunden gelten sollen. Dazu ist es notwendig, den aktuellen Bestand zu kennen oder sich zumindest telefonisch mit dem Gruppenleiter vor Ort abzusprechen, damit die bestellten Liefermengen zu erreichen sind.
Der Tipp: Einige Fotos mit dem Handy (geschickt per MMS) liefern schnell eindeutige Informationen und können langwierige Diskussionen ersparen.
Eindeutige Qualität bedeutet nicht einzigartige Qualität
Da Pflanzen eben keine Zündkerzen oder Schrauben sind, findet sich nie die einzig richtige Größe, das einzig richtige Gewicht, auch wenn diese Idealausgabe in der Qualitätsbeschreibung abgebildet ist. Der Optimalwert interessiert in der Praxis nicht. Gesucht ist die zulässige Spanne (siehe Abbildung 1). Aus diesem Grund müssen den Arbeitskräften Maximal- und Minimalwerte kommuniziert werden.
Idealerweise geschieht dies als real greifbares Beispiel, indem zum Beispiel an den Rand des Beetes zwei Töpfe mit Schnittlauch gestellt werden. Gesucht und gerichtet wird so: Nicht kleiner als im linken Topf und nicht größer als im rechten Topf.
Der Vergleich hinkt, Stichproben sind deshalb unerlässlich
Beim Richten oder Ernten der Ware dürfen keine Vergleiche innerhalb des vorliegenden Bestands angestellt werden. Gültig ist die objektive Qualitätsnorm der Vorgabe.
Der Effekt ist nur zu bekannt: In einem Feld oder einem Gewächshaus mit sehr gutem Bestand, wachsen verhältnismäßig große Früchte, und so erscheint einem die ausreichende Lieferqualität plötzlich klein und schmächtig. Tendenziell wird durch diese Sichtweise Gemüse in einem zu großen Wachstumsstadium geerntet. Steht man in einem Bestand mit relativ kleinen Früchten, kommt es zum umgekehrten Effekt.
Stichprobenvergleiche, wie das Wiegen der Gurke in Abbildung 2, sind unerlässlich.
Zur Objektivierung in der Praxis körpereigene Maße nutzen
Messschablone und Metermaß sind – arbeitswirtschaftlich gesehen – bei der Ernte unpraktische Hilfsmittel. Sie zwingen zu zusätzlichen zeitraubenden Vorgängen. Zur Überprüfung einer Größe bieten sich daher körpereigene Maße oder Maße am verwendeten Werkzeug (Schere, Messer) viel besser an.
Diese Werkzeuge sind nah am Produkt und sollten so gewählt werden, dass mit dem Erntevorgang automatisch die Überprüfung der Größe stattfindet.
Beim Schneiden von Grünspargel zum Beispiel hilft eine Markierung am Unterarm. Beim Ansetzen des Messers am Grund des Spargels sieht der Erntearbeiter sofort, ob die gewünschte Länge erreicht wird.
Gewichte austarieren und die Sache mit der Digitalwaage
In teureren Preisklassen wie zum Beispiel bei Zucchini oder Chicorée bedeutet jedes verkaufte Gramm Gemüse bares Geld. Dort besteht das Bestreben, das Zielgewicht möglichst exakt zu erreichen.
Beim Auswiegen beginnt ein Tauschen und Testen auf der Waage, um die Idealkombination zusammenzustellen. Der erste Tipp hierbei besteht darin, das Schätzen der Gewichte aktiv zu üben. „Wenn 50 g fehlen, wie würden Sie austauschen?“ Ein anderes Handicap besteht in der Erfassung der Gewichtsdifferenz. Viele Aushilfskräfte haben Schwierigkeiten den Gewichtsunterschied bei Digitalwaagen auszurechnen (siehe Abbildung 3). Eine Analogwaage mit Zeiger auf der Skala, zeigt sichtbar, ob viel oder wenig Abweichung zum Idealgewicht besteht. Eine rotgrüne Farbmarkierung verdeutlicht Unteroder Übergewicht.
Einüben, Gewichte zu schätzen und Stichproben durchführen
Es sollen Kohlköpfe zu einem Kilogramm herausgesucht werden. Die Platzierung eines „Modell-Kohlkopfes“ hilft den Arbeitskräften bei dieser Aufgabe weiter.
Am Anfang wird noch jeder Kopf zur Probe gewogen. Nach einer Einübungsphase, gibt es viele Mitarbeiter, die auf Anhieb die richtigen Köpfe aus der Großkiste greifen, und bei denen das Wiegen nur noch stichprobenartig notwendig ist. Ähnliches gilt, wenn Produkte in Schalen abgepackt werden sollen. Durch den Füllgrad der Schale und das Gewicht in der Hand entwickelt sich bald ein sicheres Gefühl für die notwendige Menge.
Selbstverständlich dürfen keine Untergewichte entstehen. Bei Schätzverfahren wird Übergewicht verkauft, aber der zeitund kostenaufwändige Wiegevorgang findet bei Niedrig-Preis-Produkten nur in Stichproben oder am Schluss auf der Verpackungslinie statt.
Mit Köpfchen zum „Ja – Ernte“ oder „Nein – bleibt stehen“
Wird zum Beispiel ein Salatfeld abgeerntet, ist der Pflanzenbestand Reihe für Reihe und Kopf für Kopf vor dem Schnitt zu beurteilen. Kontrolliert wird systematisch in Schlangenlinien entlang der Pflanzreihen. Jede Prüfung wird nur ein einziges Mal durchgeführt. Entweder es folgt ein „Ja“ und der Kopf wird geschnitten oder es kommt zu einem „Nein“. Dann bleibt der Kopf stehen.
Es gibt auf jeden Fall kein „Vielleicht“. Es hilft auch nichts, einen Kohlkopf stehen zu lassen und eine Minute später noch einmal in Augenschein zu nehmen. Ein rigoroses Vorgehen fällt vielen Menschen schwer. Bei der Einweisung wurde meist nur geübt, wie der Kopf geschnitten wird. Die dem Schnitt vorangehende Entscheidungsfindung „welchen Kopf schneide ich“ führt zu Zögern und Zeiteinbußen und muss daher auch „trainiert werden“.
Top oder Flop: Spielerisch zur Entscheidungsfindung
Um Routine für eine schnelle und richtige Entscheidungsfindung zu entwickeln, empfiehlt sich folgendes „Spiel“:
> Der Gruppenleiter stellt sich in eine kleine Runde von Mitarbeitern und bespricht anstehende Qualitätsvorgaben.
> Eindeutige „Fälle“ werden hochgehoben und herumgegeben, sodass jeder sprichwörtlich „Qualität begreifen“ kann.
> Nun hält der Gruppenleiter ein weiteres Beispiel von einem Produkt hoch.
> Alle Personen zeigen mit geschlossenen Augen mit dem Daumen nach unten ein „Nein“ oder mit dem Daumen nach oben ein „Ja“. So wird niemand vor der Gruppe blamiert, trotzdem sind die Einzelentscheidungen abprüfbar. Bei Fehlentscheidungen werden die zutreffenden Kriterien im Detail verdeutlicht.
> Die Schwierigkeitsgrade steigen. Zu guter Letzt nimmt man Grenzfälle, für die ein „Ja“ und ein „Nein“ akzeptabel wäre (Abbildung 4a und 4b).
Mit Humor und guter Laune durchgeführt, stärkt man auf diese Weise spielerisch die Sicherheit in der Runde und zeigt dem Vorarbeiter, bei welcher Arbeitskraft er noch einmal vorbeischauen sollte.
In »Gemüse« Nr. 8/2012 wird die Effizienz bei der Tomatenernte im Gewächshaus durchleuchtet.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen