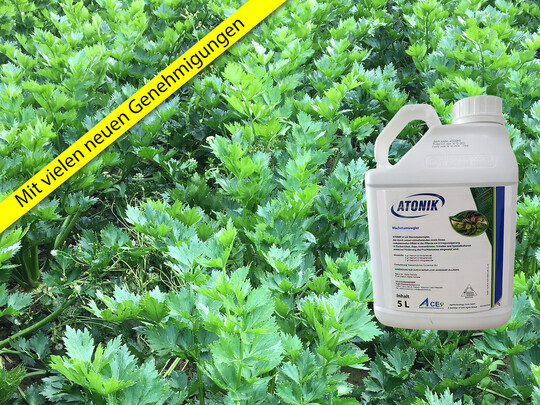Regional + saisonal = ökologisch korrekt?
An was sollen wir Verbraucher beim Gemüseeinkauf nicht alles denken? Regional produzierte Ware ist besser als importierte, heißt ein Leitsatz. Es leuchtet noch relativ gut ein, dass Salat, der in Bayern wächst und dort gekauft und verzehrt wird, als ökologischer gilt, als Salat, der aus Spanien importiert wurde, dies schon allein wegen der weiteren Transportwege. Aber jetzt kommt’s: Salat aus der Region kann auch eine schlechtere Öko-Bilanz haben als spanischer – vor allem im Winter.
- Veröffentlicht am
Wie das? Dr. Guido Reinhardt, Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg, erklärt es so: Der hohe Energieverbrauch beim Salatanbau im beheizten Glashaus verursacht mehr Treibhauseffekt als der LKW-Transport spanischen Salats, der ohne Heizung erzeugt werden konnte. Wer hätte das gedacht? Ich nicht.
Aber genau der Energieverbrauch für den Winteranbau ist die Stellschraube, um die Öko-Bilanz wieder zu Gunsten des regionalen Produkts zu drehen. Kultiviert man den Salat im kalten Gewächshaus oder nutzt regenerative Energie, sinkt der Treibhauseffekt unter den des Import-Salats.
In einer Öko-Bilanz wird laut Reinhardt der komplette Lebensweg eines Produkts betrachtet. Beim Salat heißt das: vom Anbau über Transporte und Verpackung bis zum Einkauf des Verbrauchers.
Beim Anbau wird nicht nur die verwendete Heizenergie betrachtet, auch das Kulturverfahren (Freiland, Folientunnel, Gewächshaus) oder der Düngemitteleinsatz werden miteingerechnet.
So „wiegt“ ein Gewächshaus durch mehr verwendetes Metall und Glasscheiben weit mehr als ein einfacher Folientunnel mit relativ wenig Metall – bezogen auf den Treibhauseffekt.
Wir haben den Salat jetzt also optimal produziert: Im Sommer im Freiland ohne Folie, im Winter im mit regenerativer Energie beheizten Haus. Damit ist der Einfluss des Produzenten schon fast erschöpft.
Vermarkten Sie den produzierten Salat dann noch selbst – zum Beispiel über Wochenmarkt oder Hofladen – prima! So können Sie unnötige Plastikverpackungen vermeiden. Aber auch im Direktabsatz steckt ein Detail, das nicht vernachlässigt werden darf, sagt Dr. Reinhardt: „Die Kunden fahren mit ihren dicken Geländewagen auf den Hof und kaufen dort relativ wenig ein. Dann ist die Öko-Bilanz wieder viel schlechter, als wenn die Kunden direkt auf dem Heimweg vom Büro relativ viele Lebensmittel im Einzelhandel einkaufen.“ Man kann also beim Anbau alles richtig gemacht haben – der Konsument hat es schlussendlich in der Hand, die Ökobilanz wieder zu verändern.
Was kann man dem Verbraucher aber beim Einkauf an die Hand geben, dass er sich dort für das ökologisch sinnvoll produzierte Produkt entscheidet?
In vielen Ländern wird bereits mit dem sogenannten „Carbon Footprint“ gearbeitet. Es wird bei jedem Produkt angegeben, wie viel CO2 bei der Erzeugung angefallen ist. Klingt erst mal gut. So könnte man schnell und einfach Artikel untereinander vergleichen. Das macht aber bei Gemüse herzlich wenig Sinn. Unterscheidet sich doch der Treibhauseffekt von Gemüse erheblich, je nachdem wo und wie es angebaut wurde. Der Energieaufwand und somit der Treibhauseffekt von Kopfsalat kann sich durch Beheizung schnell mal verfünffachen. Im Handel müsste also zu jeder Charge Gemüse ein anderer Wert angegeben werden, das ist nicht praktikabel.
Zumal wir ja nun wissen, dass das Verhalten des Verbrauchers den eigentlich größeren Einfluss hat als der Anbau selbst. Was kann man also empfehlen?
Dass Gemüse möglichst regional und saisonal gekauft werden sollte, wissen Verbraucher ja eigentlich. Am ökologischsten ist es, wenn sie zu Fuß oder per Fahrrad auf dem Wochenmarkt einkaufen und noch auf Plastikverpackungen verzichten.
Wenn Sie Ihr Gemüse ab Hof vermarkten, könnten Sie die Kunden darauf hinweisen, dass dann große Mengen an CO2 einspart werden. Denkbar wäre auch ein „Öko- Bonus“ für Kunden, die eben nicht mit dem Auto kommen. Der Bonus könnte als kleiner Rabatt beim Einkauf verrechnet werden.
Es ist vor allem das lange geforderte Umdenken der Bevölkerung – hin zu einem bewussteren Kosum. Ob sich das in absehbarer Zeit einstellen wird, ist fraglich.
Aber genau der Energieverbrauch für den Winteranbau ist die Stellschraube, um die Öko-Bilanz wieder zu Gunsten des regionalen Produkts zu drehen. Kultiviert man den Salat im kalten Gewächshaus oder nutzt regenerative Energie, sinkt der Treibhauseffekt unter den des Import-Salats.
In einer Öko-Bilanz wird laut Reinhardt der komplette Lebensweg eines Produkts betrachtet. Beim Salat heißt das: vom Anbau über Transporte und Verpackung bis zum Einkauf des Verbrauchers.
Beim Anbau wird nicht nur die verwendete Heizenergie betrachtet, auch das Kulturverfahren (Freiland, Folientunnel, Gewächshaus) oder der Düngemitteleinsatz werden miteingerechnet.
So „wiegt“ ein Gewächshaus durch mehr verwendetes Metall und Glasscheiben weit mehr als ein einfacher Folientunnel mit relativ wenig Metall – bezogen auf den Treibhauseffekt.
Wir haben den Salat jetzt also optimal produziert: Im Sommer im Freiland ohne Folie, im Winter im mit regenerativer Energie beheizten Haus. Damit ist der Einfluss des Produzenten schon fast erschöpft.
Vermarkten Sie den produzierten Salat dann noch selbst – zum Beispiel über Wochenmarkt oder Hofladen – prima! So können Sie unnötige Plastikverpackungen vermeiden. Aber auch im Direktabsatz steckt ein Detail, das nicht vernachlässigt werden darf, sagt Dr. Reinhardt: „Die Kunden fahren mit ihren dicken Geländewagen auf den Hof und kaufen dort relativ wenig ein. Dann ist die Öko-Bilanz wieder viel schlechter, als wenn die Kunden direkt auf dem Heimweg vom Büro relativ viele Lebensmittel im Einzelhandel einkaufen.“ Man kann also beim Anbau alles richtig gemacht haben – der Konsument hat es schlussendlich in der Hand, die Ökobilanz wieder zu verändern.
Was kann man dem Verbraucher aber beim Einkauf an die Hand geben, dass er sich dort für das ökologisch sinnvoll produzierte Produkt entscheidet?
In vielen Ländern wird bereits mit dem sogenannten „Carbon Footprint“ gearbeitet. Es wird bei jedem Produkt angegeben, wie viel CO2 bei der Erzeugung angefallen ist. Klingt erst mal gut. So könnte man schnell und einfach Artikel untereinander vergleichen. Das macht aber bei Gemüse herzlich wenig Sinn. Unterscheidet sich doch der Treibhauseffekt von Gemüse erheblich, je nachdem wo und wie es angebaut wurde. Der Energieaufwand und somit der Treibhauseffekt von Kopfsalat kann sich durch Beheizung schnell mal verfünffachen. Im Handel müsste also zu jeder Charge Gemüse ein anderer Wert angegeben werden, das ist nicht praktikabel.
Zumal wir ja nun wissen, dass das Verhalten des Verbrauchers den eigentlich größeren Einfluss hat als der Anbau selbst. Was kann man also empfehlen?
Dass Gemüse möglichst regional und saisonal gekauft werden sollte, wissen Verbraucher ja eigentlich. Am ökologischsten ist es, wenn sie zu Fuß oder per Fahrrad auf dem Wochenmarkt einkaufen und noch auf Plastikverpackungen verzichten.
Wenn Sie Ihr Gemüse ab Hof vermarkten, könnten Sie die Kunden darauf hinweisen, dass dann große Mengen an CO2 einspart werden. Denkbar wäre auch ein „Öko- Bonus“ für Kunden, die eben nicht mit dem Auto kommen. Der Bonus könnte als kleiner Rabatt beim Einkauf verrechnet werden.
Es ist vor allem das lange geforderte Umdenken der Bevölkerung – hin zu einem bewussteren Kosum. Ob sich das in absehbarer Zeit einstellen wird, ist fraglich.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen