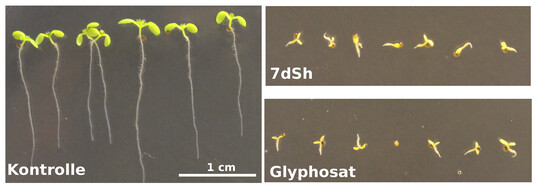Kommentar
Heimat „schmeckt“ und schafft Vertrauen
Dem Verbraucher fällt die Qualitätsbeurteilung von Lebensmitteln nicht immer leicht. Eine zunehmend komplexe, arbeitsteilige und entfremdete Lebensmittelproduktion trägt neben einer großen Produktvielfalt zur Verunsicherung bei.
- Veröffentlicht am
Wettbewerber werden angesichts des reichhaltigen Produktangebotes gegenseitig vor immer neue Herausforderungen gestellt, um die Aufmerksamkeit auf ihre Waren zu lenken.
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich Verbraucher bei der Produktwahl an Marke, Preis und Herkunft orientieren und auch der Markenzusatz „Bio“ sich durchaus kaufentscheidend auswirken kann. Die Wahrnehmung regionaler Lebensmittel hat zugenommen, und das Vertrauen in traditionelle, regionale Erzeugnisse ist gestiegen.
Die sprichwörtlich übersättigten Verbraucher ziehen zunehmend bei der Ernährung die Qualität der Quantität vor und achten bei der ernährungsbewusst orientierten Produktauswahl auch auf die geographische Herkunftsangabe. Die Vermarktung regionaler Erzeugnisse ist aus ökonomischer Sicht durchaus profitabel.
Bei der Vermarktung regionaler Produkte erfährt die geographische Herkunftsangabe, ausgedrückt beispielsweise durch die bildliche Darstellung des Bodensees auf der Produktverpackung, eine zu nehmend wichtige Bedeutung, die im Unterschied zur oftmals phantasiereichen Hersteller- oder Händlermarke sicherlich eine der ursprünglichsten Formen der Warenkennzeichnung ist.
Empirische Erhebungen zeigen, dass die Herkunftsangabe zwischenzeitlich durchaus der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln dient und entscheidend Einfluss auf die Kaufabsicht ausübt, ganz abgesehen davon, dass selbstverständlich eine als gut wahrgenommene Qualität die Zahlungsbereitschaft positiv beeinflusst.
Eine geographische Herkunftsangabe, weist auf die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Land, einer bestimmten Gegend oder Landschaft hin und bürgt quasi für eine besondere Güte und Qualität. Jedenfalls wird dies dem Verbraucher so suggeriert. Hierzu gehören beispielsweise die Produktbezeichnung „Nürnberger Lebkuchen“ oder „Österreichischer Bergkäse“ oder die Verwendung eines charakteristischen Herkunftssymbols, wie die Schweizer Nationalflagge, der Kölner Dom oder das Lübecker Holstentor.
Im Unterschied zur Herkunftsbezeichnung vermittelt eine bloße Gattungsbezeichnung den Verbrauchern lediglich einen Hinweis auf eine bestimmte Warenart mit einer bestimmten Beschaffenheit, ohne dass hiermit eine Vorstellung über eine konkrete geographische Herkunft verbunden wird.
So ist im Falle der Bezeichnung „Peking Ente“ dem Verbraucher sehr wohl bewusst, dass diese ihm im Restaurant servierte Ente nicht direkt aus Peking stammt. Ebenso verhält es sich im Fall Linzer Torte, Schwarzwälder Kirschtorte, des Wiener Schnitzels, des Toasts Hawaii oder ähnlichen Bezeichnungen.
Die Unterscheidung einer Herkunfts- von einer Gattungsbezeichnung ist für den Verbraucher nicht immer leicht, was sich die Hersteller wohl wissend im umkämpften Lebensmittelmarkt zu Nutze machen.
Hersteller sollten den wirtschaftlichen Wert einer Marke als Werbemittel für ein Qualitätsprodukt nicht verkennen. Nur ein umfassend markenrechtlich geschützter Produktname und eine gute Werbestrategie bei einwandfreier Qualität ermöglichen es, auch gegenüber der internationalen Konkurrenz Stand zu halten und sich weiterhin auf dem Markt zu behaupten. Markenschutz sollte in Anbetracht des wirtschaftlichen Nutzens als Investition in das Image des Produktes begriffen werden und nicht nur als lästige bürokratische Förmelei.
Die vielen Schreckensmeldungen von pestizidbelastetem Obst und Gemüse auch aus dem Ausland werden es auch in Zukunft nicht leicht machen, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Produzenten und Händler werden sich etwas einfallen lassen müssen.
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich Verbraucher bei der Produktwahl an Marke, Preis und Herkunft orientieren und auch der Markenzusatz „Bio“ sich durchaus kaufentscheidend auswirken kann. Die Wahrnehmung regionaler Lebensmittel hat zugenommen, und das Vertrauen in traditionelle, regionale Erzeugnisse ist gestiegen.
Die sprichwörtlich übersättigten Verbraucher ziehen zunehmend bei der Ernährung die Qualität der Quantität vor und achten bei der ernährungsbewusst orientierten Produktauswahl auch auf die geographische Herkunftsangabe. Die Vermarktung regionaler Erzeugnisse ist aus ökonomischer Sicht durchaus profitabel.
Bei der Vermarktung regionaler Produkte erfährt die geographische Herkunftsangabe, ausgedrückt beispielsweise durch die bildliche Darstellung des Bodensees auf der Produktverpackung, eine zu nehmend wichtige Bedeutung, die im Unterschied zur oftmals phantasiereichen Hersteller- oder Händlermarke sicherlich eine der ursprünglichsten Formen der Warenkennzeichnung ist.
Empirische Erhebungen zeigen, dass die Herkunftsangabe zwischenzeitlich durchaus der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln dient und entscheidend Einfluss auf die Kaufabsicht ausübt, ganz abgesehen davon, dass selbstverständlich eine als gut wahrgenommene Qualität die Zahlungsbereitschaft positiv beeinflusst.
Eine geographische Herkunftsangabe, weist auf die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Land, einer bestimmten Gegend oder Landschaft hin und bürgt quasi für eine besondere Güte und Qualität. Jedenfalls wird dies dem Verbraucher so suggeriert. Hierzu gehören beispielsweise die Produktbezeichnung „Nürnberger Lebkuchen“ oder „Österreichischer Bergkäse“ oder die Verwendung eines charakteristischen Herkunftssymbols, wie die Schweizer Nationalflagge, der Kölner Dom oder das Lübecker Holstentor.
Im Unterschied zur Herkunftsbezeichnung vermittelt eine bloße Gattungsbezeichnung den Verbrauchern lediglich einen Hinweis auf eine bestimmte Warenart mit einer bestimmten Beschaffenheit, ohne dass hiermit eine Vorstellung über eine konkrete geographische Herkunft verbunden wird.
So ist im Falle der Bezeichnung „Peking Ente“ dem Verbraucher sehr wohl bewusst, dass diese ihm im Restaurant servierte Ente nicht direkt aus Peking stammt. Ebenso verhält es sich im Fall Linzer Torte, Schwarzwälder Kirschtorte, des Wiener Schnitzels, des Toasts Hawaii oder ähnlichen Bezeichnungen.
Die Unterscheidung einer Herkunfts- von einer Gattungsbezeichnung ist für den Verbraucher nicht immer leicht, was sich die Hersteller wohl wissend im umkämpften Lebensmittelmarkt zu Nutze machen.
Hersteller sollten den wirtschaftlichen Wert einer Marke als Werbemittel für ein Qualitätsprodukt nicht verkennen. Nur ein umfassend markenrechtlich geschützter Produktname und eine gute Werbestrategie bei einwandfreier Qualität ermöglichen es, auch gegenüber der internationalen Konkurrenz Stand zu halten und sich weiterhin auf dem Markt zu behaupten. Markenschutz sollte in Anbetracht des wirtschaftlichen Nutzens als Investition in das Image des Produktes begriffen werden und nicht nur als lästige bürokratische Förmelei.
Die vielen Schreckensmeldungen von pestizidbelastetem Obst und Gemüse auch aus dem Ausland werden es auch in Zukunft nicht leicht machen, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Produzenten und Händler werden sich etwas einfallen lassen müssen.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen