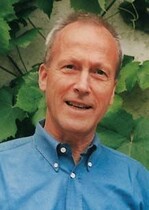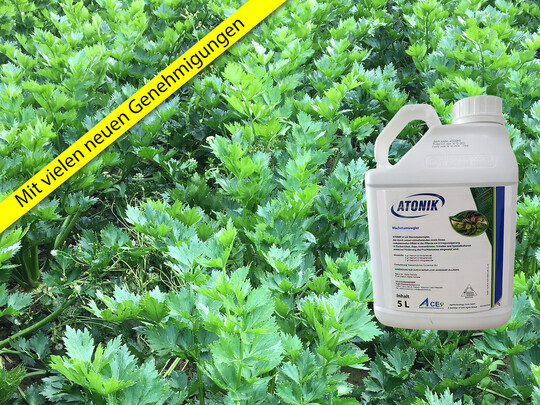Der ewige Streit um „bio“ oder nicht
Wie schon so oft in den letzten Jahrzehnten – ein groß aufgemachter Bericht über die Qualität von Bio-Lebensmitteln im Vergleich zu konventionell erzeugten, dieses Mal von Stiftung Warentest unter der Überschrift „Der Bio-Check“ mit einer Bilanz aus 85 Lebensmitteltests seit 2002. Das Resümee: „Bio gleichauf mit konventionell.“
- Veröffentlicht am
Und wieder einmal kommen Aussagen und Interpretationen zu Stande, die Grundfragen nicht beantworten:
Gibt es mit Blick auf den Nahrungswert einen prinzipiellen Unterschied zwischen „bio“ und „nichtbio“? Sind also der höhere Aufwand der im Schnitt um 30 % niedrigere Ertrag gerechtfertigt, und muss der Verbraucher dann eben auch den notwendigen höheren Preis bezahlen?
Natürlich kann man das Thema nur betriebs- oder marktwirtschaftlich betrachten: Wenn Verbraucher davon überzeugt sind, dass ihnen Bio-Qualität gut tut, und wenn sie bereit sind, den höheren Aufwand zu bezahlen, dann ist es gutes unternehmerisches Verhalten, diese Nachfrage zu befriedigen.
Schwieriger wird es, wenn es um eine objektive Beurteilung der gestellten Fragen geht. Seit vor achtzig Jahren Rudolf Steiner erstmals Grundsätze der biologisch- dynamischen Landbewirtschaftung formulierte und damit die Landbauwissenschaft provozierte, wurde vielfach versucht, Unterschiede zwischen biologisch und konventionell erzeugten Nahrungsmitteln zu belegen oder eher zu widerlegen. Ansätze hierzu waren unter anderem: Kupferkristallisationsbilder, Fütterungsversuche mit Tieren, Fruchtbarkeitsvergleiche bei Kaninchen, Ernährungsvergleiche bei Kleinkindern, Geschmackstests, Haltbarkeitsvergleiche, Vergleich der Biophotonenstrahlung sowie natürlich immer wieder die Analyse von wertgebenden Inhaltsstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, gelegentlich Eiweißqualität, Ballaststoffe und neuerdings häufig auch bioaktive Substanzen. Dazu kam die Analyse von unerwünschten Stoffen mit dem Schwerpunkt auf Rückständen von Pflanzenschutzmitteln und lange Jahre auch auf Nitrat.
Etwas vereinfachend lassen sich zwei Aussagen zu den Ergebnissen der genannten Untersuchungen machen: So halten erstens praktisch alle Vergleiche von Produkten aus Bio-Anbau mit jenen aus konventioneller Bewirtschaftung aus methodischen Gründen einer strengen Prüfung nicht stand.
Entweder sind die angewandten Methoden nicht wissenschaftlich anerkannt, oder es sind die Produkte nicht wirklich vergleichbar, weil sie von unterschiedlichen Standorten, unterschiedlichen Anbauzeiten, unterschiedlichen Sorten, mit unterschiedlichem Reifegrad, unterschiedlichen Lagerbedingungen usw. stammen – alles Faktoren, die die Eigenschaften stark beeinflussen und die Unterschiede in Anbausystemen oft weit übertreffen.
Man kann sich, ob der Naivität, mit der bestimmte Organisationen in den Supermärkten einige Salatköpfe kaufen und dann Grundsatzaussagen über Bio- Produkte machen, nur wundern, auch darüber, dass Statistiker dies nicht wirklich hinterfragen.
Zweitens sind bei den chemischen Analysen tendenziell Unterschiede zu Gunsten der Bio-Produkte zu finden (häufig höhere Vitamin-C-Gehalte, gelegentlich höherer Zuckergehalt, gelegentlich höhere Flavonoidgehalte, tendenziell höhere Mineralstoff- und Spurenelementgehalte, oft weniger Nitrat, meistens niedrigere oder keine Pflanzenschutzmittelrückstände). Die Unterschiede bei den Inhaltsstoffen können – soweit sie auftreten – in fast allen Fällen damit erklärt werden, dass den Pflanzen im Bio-Anbau weniger Stickstoff zur Verfügung steht.
Aber auch wenn die genannten Unterschiede sicher wären, gibt es keinen Nachweis und auch keinen gesicherten Ansatz für einen Einfluss auf unsere Gesundheit.
Die Versorgung mit essenziellen Stoffen aus Pflanzen hängt um ein Vielfaches mehr davon ab, welche Zusammensetzung unsere Nahrung hat.
Und bei den Pflanzenschutzmittelrückständen wurde eine derart hohe Sicherheitsreserve geschaffen, dass trotz der regelmäßigen Horrormeldungen Sorgen um die Gesundheit nicht bestehen müssen. Die in vielen Untersuchungen belegte Tatsache, dass Menschen, die viel Gemüse essen, ein geringeres Krankheitsrisiko haben, spricht für sich.
Aus gesundheitlichen Gründen muss also niemand seine Ernährung auf Bio- Produkte umstellen. Und doch erlebe ich in Vorträgen Diskussionsbeiträge der Art: „Wenn ich einen gespritzten Apfel esse, bekomme ich sofort eine starke Mundschleimhautentzündung, bei Bio-Äpfeln nicht“; „wenn ich normalen Kopfsalat esse, habe ich massive Verdauungsprobleme, bei Bio- Salat nicht“. Wie passt das mit der sachlichen Bewertung zusammen?
Bleibt am Ende diese Frage: Gibt es eine Wahrheit außerhalb der wissenschaftlichen Beweisbarkeit, und spielen die Psyche, der Glaube, die Überzeugung eine Rolle bei der Wirkung von Nahrungsmitteln? Mindestens in Geschmackstest sind Veränderungen der Rezeptoren als Folge von Überzeugungen gesichert nachgewiesen.
Gibt es mit Blick auf den Nahrungswert einen prinzipiellen Unterschied zwischen „bio“ und „nichtbio“? Sind also der höhere Aufwand der im Schnitt um 30 % niedrigere Ertrag gerechtfertigt, und muss der Verbraucher dann eben auch den notwendigen höheren Preis bezahlen?
Natürlich kann man das Thema nur betriebs- oder marktwirtschaftlich betrachten: Wenn Verbraucher davon überzeugt sind, dass ihnen Bio-Qualität gut tut, und wenn sie bereit sind, den höheren Aufwand zu bezahlen, dann ist es gutes unternehmerisches Verhalten, diese Nachfrage zu befriedigen.
Schwieriger wird es, wenn es um eine objektive Beurteilung der gestellten Fragen geht. Seit vor achtzig Jahren Rudolf Steiner erstmals Grundsätze der biologisch- dynamischen Landbewirtschaftung formulierte und damit die Landbauwissenschaft provozierte, wurde vielfach versucht, Unterschiede zwischen biologisch und konventionell erzeugten Nahrungsmitteln zu belegen oder eher zu widerlegen. Ansätze hierzu waren unter anderem: Kupferkristallisationsbilder, Fütterungsversuche mit Tieren, Fruchtbarkeitsvergleiche bei Kaninchen, Ernährungsvergleiche bei Kleinkindern, Geschmackstests, Haltbarkeitsvergleiche, Vergleich der Biophotonenstrahlung sowie natürlich immer wieder die Analyse von wertgebenden Inhaltsstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, gelegentlich Eiweißqualität, Ballaststoffe und neuerdings häufig auch bioaktive Substanzen. Dazu kam die Analyse von unerwünschten Stoffen mit dem Schwerpunkt auf Rückständen von Pflanzenschutzmitteln und lange Jahre auch auf Nitrat.
Etwas vereinfachend lassen sich zwei Aussagen zu den Ergebnissen der genannten Untersuchungen machen: So halten erstens praktisch alle Vergleiche von Produkten aus Bio-Anbau mit jenen aus konventioneller Bewirtschaftung aus methodischen Gründen einer strengen Prüfung nicht stand.
Entweder sind die angewandten Methoden nicht wissenschaftlich anerkannt, oder es sind die Produkte nicht wirklich vergleichbar, weil sie von unterschiedlichen Standorten, unterschiedlichen Anbauzeiten, unterschiedlichen Sorten, mit unterschiedlichem Reifegrad, unterschiedlichen Lagerbedingungen usw. stammen – alles Faktoren, die die Eigenschaften stark beeinflussen und die Unterschiede in Anbausystemen oft weit übertreffen.
Man kann sich, ob der Naivität, mit der bestimmte Organisationen in den Supermärkten einige Salatköpfe kaufen und dann Grundsatzaussagen über Bio- Produkte machen, nur wundern, auch darüber, dass Statistiker dies nicht wirklich hinterfragen.
Zweitens sind bei den chemischen Analysen tendenziell Unterschiede zu Gunsten der Bio-Produkte zu finden (häufig höhere Vitamin-C-Gehalte, gelegentlich höherer Zuckergehalt, gelegentlich höhere Flavonoidgehalte, tendenziell höhere Mineralstoff- und Spurenelementgehalte, oft weniger Nitrat, meistens niedrigere oder keine Pflanzenschutzmittelrückstände). Die Unterschiede bei den Inhaltsstoffen können – soweit sie auftreten – in fast allen Fällen damit erklärt werden, dass den Pflanzen im Bio-Anbau weniger Stickstoff zur Verfügung steht.
Aber auch wenn die genannten Unterschiede sicher wären, gibt es keinen Nachweis und auch keinen gesicherten Ansatz für einen Einfluss auf unsere Gesundheit.
Die Versorgung mit essenziellen Stoffen aus Pflanzen hängt um ein Vielfaches mehr davon ab, welche Zusammensetzung unsere Nahrung hat.
Und bei den Pflanzenschutzmittelrückständen wurde eine derart hohe Sicherheitsreserve geschaffen, dass trotz der regelmäßigen Horrormeldungen Sorgen um die Gesundheit nicht bestehen müssen. Die in vielen Untersuchungen belegte Tatsache, dass Menschen, die viel Gemüse essen, ein geringeres Krankheitsrisiko haben, spricht für sich.
Aus gesundheitlichen Gründen muss also niemand seine Ernährung auf Bio- Produkte umstellen. Und doch erlebe ich in Vorträgen Diskussionsbeiträge der Art: „Wenn ich einen gespritzten Apfel esse, bekomme ich sofort eine starke Mundschleimhautentzündung, bei Bio-Äpfeln nicht“; „wenn ich normalen Kopfsalat esse, habe ich massive Verdauungsprobleme, bei Bio- Salat nicht“. Wie passt das mit der sachlichen Bewertung zusammen?
Bleibt am Ende diese Frage: Gibt es eine Wahrheit außerhalb der wissenschaftlichen Beweisbarkeit, und spielen die Psyche, der Glaube, die Überzeugung eine Rolle bei der Wirkung von Nahrungsmitteln? Mindestens in Geschmackstest sind Veränderungen der Rezeptoren als Folge von Überzeugungen gesichert nachgewiesen.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen