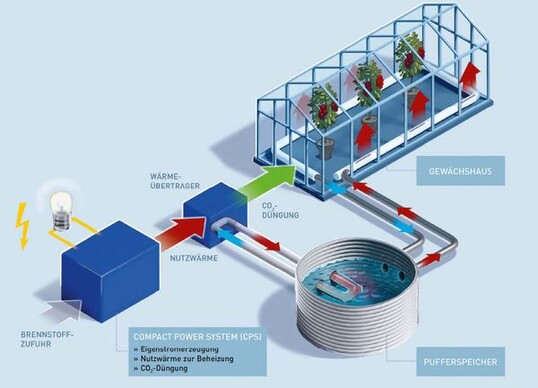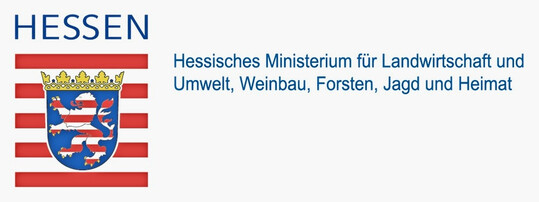Schritt für Schritt, Tropfen für Tropfen
Die vergangenen trockenen Sommer haben viele Beregnungsbetriebe an ihre Grenzen gebracht. Automatische Tropftechniksysteme könnten die Betriebe entlasten.
- Veröffentlicht am

Die Tropftechnik weist gegenüber anderen Beregnungssystemen den geringsten Energieverbrauch und die geringsten Verdunstungsraten auf. Sie hat dagegen sehr hohe Anforderungen an die Wasserqualität und der Installationsaufwand ist nicht zu vernachlässigen. Das System spielt seine Vorzüge vor allem in mehrjährigen Kulturen aus. Aus diesem Grund wurde auf dem Modellbetrieb der Wasserrahmenrichtlinie Lankes & Jacobs eine Demoanlage in Rhabarber installiert. Dort wird in den nächsten Jahren der Umgang, die Langlebigkeit des Systems und die Wassereinsparung im Vergleich zur betriebsüblichen Kanone untersucht. Außerdem wird mit der Fertigation gearbeitet. Bis allerdings die Technik gekauft beziehungsweise installiert werden kann, müssen einige Dinge beachtet werden. Dieser Prozess kann in fünf Schritte unterteilt werden, der im Folgenden beschrieben ist.
Eignet sich die Parzelle/Kultur für eine Tropfanlage?
Der erste wichtige Schritt für jeden Betrieb ist das Einholen der Information, ob die Kultur oder auch die Bewirtschaftung für die Tropftechnik geeignet ist. Bestimmte Bearbeitungsgänge wie Hacken oder Schuffeln erschweren die Arbeit mit der Tropftechnik enorm. Neben den Schläuchen auf der Parzelle muss an die Kopfleitung an den Enden gedacht werden. Zudem muss bei der Ernte darauf geachtet werden, dass die Leitungen nicht zu Schaden kommen. Bei mehrjährigen Kulturen bietet sich die Möglichkeit an, die Tropfrohre neben der Kultur leicht in die Erde zu verlegen. Damit wird die Gefahr von Vogelfraß geringer und Pflegemaßnahmen wie Mulchen werden vereinfacht. Bei Rhabarber muss ein Abstand zum Wurzelstock gehalten werden, die Schlingwurzeln der Pflanze würden ansonsten die Schläuche zusammendrücken. Die Parzellenlänge ist durch die Art der Tropfrohre begrenzt, druckkompensierte Schläuche ermöglichen eine längere Rohrlänge. Bei längeren Schlägen über 400 m wird dazu geraten von der Mitte der Parzelle in beide Richtungen Tropfrohre zu verlegen. Steigungen und Senken in der Parzelle müssen zudem beachtet werden. Soll das Vorgewende in der Parzelle mit Tropftechnik ausgestattet werden, muss die Kopfleitung auf beide Seiten gelegt werden. In Abbildung 2 ist eine Skizze der Demoanlage dargestellt. Bei der Demoanlage wurde auf ein bepflanztes Vorgewende verzichtet, außerdem wurde eine kleine Ecke mit Blühpflanzen bepflanzt. Es passen durch einen Reihenabstand von 1,5 m 66 Reihen auf die Parzelle, bei einer maximalen Länge von 120 m.
Wasserversorgung und Wasserqualität bereitstellen
Für die Tropfbewässerung ist vor allem die Wasserqualität von Bedeutung. Eisen und Mangan begrenzen durch Ablagerung die Langlebigkeit des Systems. In begrenzten Mengen kann mit Filtern oder Säuren gegen Ablagerungen vorgegangen werden. Wenn die Wasserqualität ausreichend ist, sollte – wenn möglich – eine dauerhafte Versorgung mit Wasser gegeben sein. Falls vorhandene Brunnen in der Nähe sind, muss man neben dem Druck die Pumpenleistung beachten. In unserem Fall steht eine große Pumpe zur Verfügung, welche für die Kanonenberegnung genutzt wird. Diese ist aber für diese Parzelle zu groß und die Steuerung mit parallel betriebenen Kanonen wäre zu aufwendig. Deswegen wurde auf eine kleinere Pumpe zurückgegriffen. Dementsprechend muss der Wasserbedarf der Parzelle beachtet werden. In diesem Fall wurde ein druckkompensiertes Tropfrohr der Firma Netafim verwendet. Mit einem Tropfabstand von 30 cm und einem Durchfluss von 1 l/h benötigt man rund 15 m³/h, wenn man die komplette Anlage auf einmal versorgen möchte. Da die Zuleitung für die Parzelle vorhanden war (40-er-Leitung), ist dies der begrenzende Faktor für die Wasserversorgung. Dementsprechend wurde die Parzelle in vier Segmente unterteilt, wobei jedes Segment circa 3,6 m³/h bei 2,5 bar benötigt. Jedoch sollte man bedenken, dass die Laufzeit für eine Beregnungsgabe sich erhöht, da jedes Segment nacheinander angesteuert werden muss.
Kopfstation gestalten
Nachdem die Anzahl an Segmenten, die Tropfrohre, die Wasserzufuhr und die Wasserqualität geklärt wurden, kann die Kopfstation geplant werden. Als erstes wird ein Filter an die Kopfstation gesetzt. Die Anforderungen an ihn sind je nach Wasserqualität unterschiedlich. In unserem Fall war die Wasserqualität sehr gut, es wurde daher ein relativ großer Filter mit 2“ gewählt. Dies hat den Vorteil, dass das Spülintervall größer ist. Anschließend folgt ein Druckmesser. Anhand des Druckmessers ist der Verschmutzungsgrad ablesbar. In unserem Fall kommt danach die Einspeisung zur Fertigation. Außerdem sind ein Druckminderer und ein Entlüftungsventil verbaut, um Lufteinschlüsse aus dem System zu führen. Zu guter Letzt sind eine Wasseruhr für die Mengenerfassung und Magnetventile für die einzelnen Sektionen installiert. Die Kopfstation ist in Abbildung 1 dargestellt.
Zur Ansteuerung der Sektionen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Von der händischen Steuerung bis hin zur automatischen Steuerung für Bodenfeuchtesensoren ist alles möglich. Jedes System hat Vor- und Nachteile für die Benutzer. Allerdings ist die Einarbeitung in die Steuerung der Tropftechnik, besonders am Anfang, nicht zu vernachlässigen. In unserem Fall haben wir uns für ein teilautomatisches System entschieden. Im Galcon-Steuergerät werden Beregnungszeiträume einprogrammiert, welche mengenmäßig überwacht werden. Dementsprechend werden Druckschwankungen berücksichtigt, und man kann beispielsweise jede Sektion mit 5 mm pro Tag bewässern und die Steuerung öffnet so lange ein Magnetventil, bis das benötigte Wasser durchgeflossen ist.
Zur Ermittlung der Beregnungshöhe werden pro Variante zwei Bodenfeuchte-sensoren in der Hauptwurzelzone in 15 cm Tiefe und ein Sensor in 60 cm Tiefe eingebaut. Mit dem tieferen Sensor können zu hohe Beregnungsgaben/Starkniederschläge erfasst werden.
Kopfleitung und Tropfrohre verlegen
Es gibt, wie anfangs bereits erwähnt, die Möglichkeit, die Kopfleitung sowie die Tropfrohre überirdisch als auch unterirdisch zu verlegen. In der Regel wird die Kopfleitung unter der Erde verlegt, da man so einfacher aus den Reihen fahren kann. In unserem Fall hat der Betriebsleiter sich für die oberirdische Ablage entschieden. Damit weiß er immer genau, wo sie liegt. Die Abgänge der Tropfrohre werden je nach Reihenabstand in die Kopfleitung gebohrt und mit Schellen befestigt. Anschließend kommt ein Rohr bis zum Anfang der Reihe, erst dort wird das Tropfrohr dann gekuppelt. Ansonsten würde man Boden beregnen, welcher nicht bepflanzt ist und weil dort der Verbraucher fehlt, könnte der Boden, je nach Beregnungsmenge, vernässen. Die Tropfleitungen wurden in unserem Fall mit einem selbstgebauten Gerät verlegt.
In Abbildung 3 kann man erkennen, dass es sich dabei um ein Schar handelt, mit dem der Boden geöffnet wird. Anschließend wird das Tropfrohr mit einem Rohr auf die gewünschte Tiefe geführt und abgelegt. In diesem Fall waren es 20 cm von der Reihe entfernt und 10 cm tief im Boden. Zu beachten ist eine möglichst störungfreihe Führung des Schlauches. Umso wichtiger ist es daher, möglichst große Radien zu beachten. Am Ende jedes Schlauches hängt ein Entlüftungsventil (siehe Abbildung 4). Dieses kann man öffnen, um größere Luftmengen im Schlauch herauszuleiten, zu spülen oder den Schlauch vor dem Winter auszublasen.
Wassergaben umrechnen
Da die Wassergaben bei der Tropfbewässerung nur punktuell und nicht breitflächig abgegeben werden, muss man die Wassergaben umrechnen. Dafür sollte man zuerst die durchfeuchtete Fläche pro m² berechnen. In unserem Fall gehen wir von einem durchfeuchteten Radius von 0,2 m pro Tropfstelle aus. Mit einem Tropfabstand von 30 cm und einem Reihenabstand von 1,5 m sind es 2,2 Tropfer pro m².
Dementsprechend muss bei einer angestrebten Beregnungsgabe von 10 mm nur 2,8 mm im System beregnet werden.
In unserem Fall hat jedes Segment einen Durchsatz von 3 m³/h bei 2,5 bar. Die bepflanzte Fläche ist rund 7.000 m² groß. Bei vier Segmenten macht das 1.750 m² pro Segment. Auf diesen 1.750 m² wollen wir 2,8 l/m² Wasser ausbringen. Damit benötigen wir 4.900 l pro Segment und bei 3.600 l/h Durchsatz kommen wir auf eine Beregnungszeit von 82 Minuten pro Segment.
Zu beachten ist, dass dabei nicht pauschal 72 % Wasser eingespart werden. Gut entwickelte Pflanzen würden auch Wasser aufnehmen, das zwischen den Reihen verregnet wird. Höhere Wassergaben würden die Haltefähigkeit des Bodens überschreiten und in tiefere Schichten versickern. Demnach sollte auch bei üblichen Beregnungsgängen ermittelt werden, wieviel Wasser der Boden in den einzelnen Schichten speichern kann und demnach die Wassergaben anpassen.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen