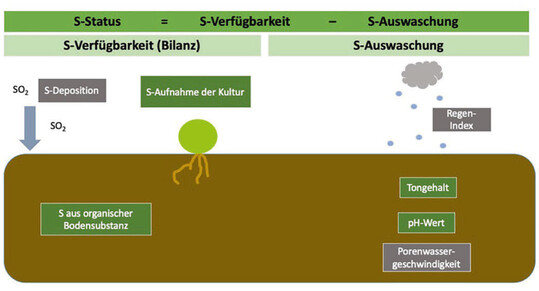
Spagat zwischen notwendiger Düngung und geringer Auswaschung
Wie sieht die Düngung zukünftig aus? Diese Frage versuchen Manfred Kohl, Leiter des Fachbereichs Gartenbau, und Dr. Karsten Lindemann-Zutz, Referent für Pflanzenernährung und Koordination Wasserschutz von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen zu beantworten.
von Jessica Schröer erschienen am 13.08.2024Sehen Sie bei der Düngung generell Einsparpotenzial? Manfred Kohl: Ich denke, dass durch eine noch bessere Ausnutzung der Fruchtfolgen und eine präzise Ausbringungstechnik Dünger eingespart werden kann. Mit einer guten Fruchtfolge kann das Stickstoffpotenzial aus dem Boden bestmöglich genutzt werden. Zum Beispiel sollten in einer Fruchtfolge nicht nur flachwurzelnde Kulturen, sondern auch Tiefwurzler integriert werden. So können Stickstoffreserven, die durch einen längeren Regen in tiefere Bodenschichten verlagert wurden, genutzt werden und die Auswaschungsgefahr ist geringer. Karsten Lindemann-Zutz: Wenn wir beim Gemüse eine gute Qualität haben wollen, dann muss entsprechend gedüngt werden. Je weiter wir an das Minimum der Düngung kommen, desto ungleichmäßiger werden die Bestände. Besonders kritisch ist es in den roten Gebieten. In der Beratung versuchen wir mit dem Konzept des gesamtbetrieblichen N-Managements gezielt die kulturphysiologischen Besonderheiten einzelner Gemüsearten (zum Beispiel ein hoher N-Bedarf, geringe Durchwurzelungstiefe oder naturgemäß ein Zurückbleiben hoher Erntereste) über die Fruchtfolge zur Einschätzung möglicher Verlustwege für Stickstoff zu bewerten. Anhand dessen werden standortspezifisch gezielt Maßnahmen zu Steigerung der N-Effizienz gemeinsam mit den Betrieben ausgewählt (wie Teilung hoher Düngegaben, technische Lösungen, Fruchtwechsel oder Integration von Zwischenfrüchten). Diese Maßnahmen bedeuten für die Betriebe immer einen Mehraufwand und müssen gezielt ineinandergreifen, dies kann nur betriebs- und kulturindividuell sein. Ein Pauschalrezept zur Einsparung gibt es nicht. Um die Kultursicherheit nicht zu gefährden, müssen immer die Situation vor Ort sowie die angestrebten Vermarktungsziele mit betrachtet werden.
Ernten ist nicht nur für den Geldbeutel das Beste, sondern auch für das Grundwasser Manfred Kohl
Manfred Kohl: Die Düngung ist gesellschaftlich insofern ein Problem, weil der Stickstoffeintrag in das Grundwasser nicht erwünscht ist. Wasser als wichtigstes Lebensmittel und die Biodiversität sind ein hohes Gut. Aber einen Gemüseanbau ohne jeglichen Stickstoffaustrag wird es nicht geben. Für optimale Qualität brauchen wir im Gemüsebau Stickstoff, Minderqualitäten sind nicht zu vermarkten. Ein Ackerbauer kann sein Brotgetreide zu Not noch als Futtergetreide verkaufen, aber im Gemüsebau gibt es keinen Futtersalat oder Futterblumenkohl. Es läuft dann auf eine Nullernte hinaus. Der Spagat zwischen notwendiger Düngung und möglichst geringer Auswaschung bleibt eine stete Herausforderung. Was wird zukünftig die größte Herausforderung im Gemüsebau? Manfred Kohl: Das ist ganz klar der Klimawandel und der damit vorhandene Wassermangel. Der Gemüsebau ohne Bewässerung wird nicht mehr funktionieren. Das Problem ist, dass bei einem Wassermangel auch gleichzeitig die Nährstoffverfügbarkeit der Pflanzen eingeschränkt ist. Ohne Wasser kann die Stickstoffmineralisierung nicht stattfinden. Wenn es aufgrund von Trockenheit zu einem Stillstand bei der Mineralisierung kommt und erst nach der Ernte der Gemüsekultur wieder regnet, dann wird der Stickstoff im Boden erst verfügbar sein, wenn die Pflanze ihn nicht mehr braucht. Deswegen benötigen die Gemüseanbauer ein regelmäßiges Bewässerungssystem, damit das Bodenleben aktiv gehalten wird und es bei der Stickstoffmobilisierung zu keinen großen Schüben kommt. Aber auch bei zu viel Regen gilt es durch intelligente Düngung und Fruchtfolge im Boden verlagerten Stickstoff für die Kultur zu nutzen. Wie kann noch auf die unterschiedlichen Extreme des Klimawandels reagiert werden? Manfred Kohl: In trockenen Jahren brauchen wir eine Bewässerung. In nassen Jahren ist hingegen die Gefahr der Auswaschung sehr groß. Um sicherzugehen, dass die Pflanze optimal mit Stickstoff versorgt wird und um zusätzlich besser auf den Wechsel zwischen nass und trocken reagieren zu können, wäre es angebracht, die Düngung in mehrere kleine Teilgaben aufzuteilen. Leider wissen wir nie genau, wie groß das Stickstoffpotenzial im Boden ist. Das hängt wie bereits gesagt von vielen Faktoren ab. Es wäre schön, wenn wir diese Stickstoffdynamik im Boden besser vorhersagen könnten. Da hoffen wir, dass die Wissenschaft entsprechende Fortschritte macht, eventuell über Sensoren, die messen, wann eine Pflanze in den Mangel kommt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Gemüsebaubranche? Manfred Kohl: Ich würde mir wünschen, dass der Verbraucher beim Kauf von Gemüse bereit ist, Abstriche an der Optik zu akzeptieren. Ich weiß, dass es schwierig ist. Im Laden kauft man emotional ein. Und warum sollte man auch zu einem nicht so schön aussehenden Gemüse greifen, wenn in derselben Kiste oder der Kiste darunter bessere Ware liegt? Man müsste dem Käufer erklären, woran es liegt, dass das Gemüse nicht so schön aussieht. Im Lebensmitteleinzelhandel ist das natürlich schwieriger als in der Direktvermarktung. Aber wenn nicht immer so stark auf die Optik geschaut würde, dann könnten die Gemüsebauer in Sachen Düngung und Pflanzenschutz eine Menge einsparen. Ich frage mich oft: Warum muss ein Kohlrabi oder Radieschen mit Blatt verkauft werden, wenn die wenigsten Menschen die Blätter essen? Die Blätter werden mit Dünger und Pflanzenschutzmittel schön gehalten, das ist meiner Meinung nach nicht notwendig.
Wenn wir beim Gemüse eine gute Qualität haben wollen, dann muss entsprechend gedüngt werden Karsten Lindemann-Zutz








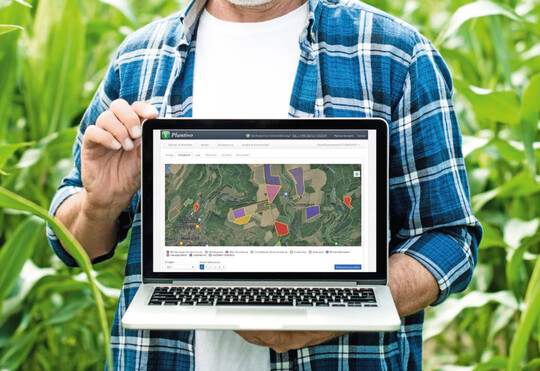




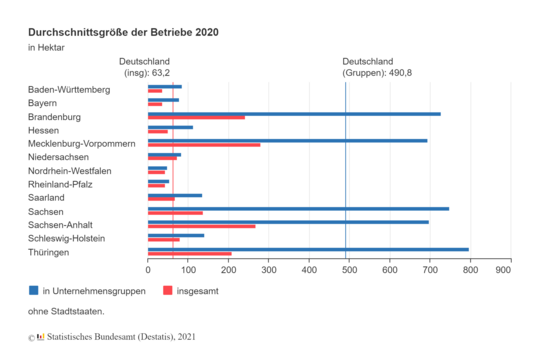




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.