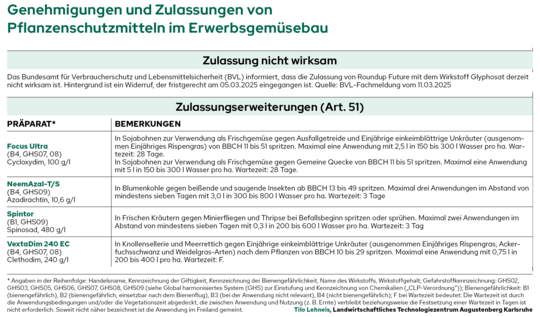
Fortschritte auf dem Weg zur Zielmarke 2030
Bis 2030 soll der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel in Baden-Württemberg um bis zu 50 % reduziert werden. Der aktuelle Bericht zeigt positive Fortschritte und verdeutlicht, wie innovative Anbaumethoden und das Netzwerk von Demobetrieben zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln beitragen. Trotz der Erfolge stellen der Klimawandel und neue Schaderreger eine Herausforderung für die Zielerreichung dar.
von Redaktion Quelle Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg erschienen am 03.12.2024„Bis zum Jahr 2030 soll die Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel im Land um 40 bis 50 % sinken. Diese Zielmarke hat sich die Landesregierung im Rahmen des Biodiversitätsstärkungsgesetzes gesetzt. Der regelmäßige Bericht zur Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel, der jetzt bereits zum vierten Mal vorgestellt wird, zeigt, wo Baden-Württemberg steht. Bezogen auf die sogenannte ‚Baseline‘, als Mittel der Jahre 2016 bis 2019, kamen im Jahr 2022, begünstigt durch die relativ trockene Witterung, 13 % weniger Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Das ist ein gutes Ergebnis in Folge. Damit setzt sich der positive Trend nach unten fort und scheint sich zu verstetigen“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, Ende November anlässlich der Vorstellung des vierten Berichts zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln in Baden-Württemberg.
Pflanzenschutzmittel reduzieren
Der Bericht basiert auf Erhebungsdaten des im Land eingerichteten Betriebsmessnetzes. Neben der reinen Mengenbewertung enthält der Bericht auch eine Risikobewertung mittels synoptischer Bewertung von Pflanzenschutzmitteln (SYNOPS). Zudem wurde im Jahr 2023, wie im Biodiversitätsstärkungsgesetz vorgesehen, eine externe, umfassende Evaluierung der Maßnahmen vorgenommen, die insgesamt positiv ausfiel.
„Unser Netzwerk aus Demobetrieben ist ein wichtiger Treiber für diesen Erfolg. Sie erproben Maßnahmen, damit landwirtschaftliche Betriebe mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen und tragen sie in die Praxis. Nach dreieinhalb Jahren Versuchsarbeit und Erfahrungsaustausch im ‚Demonstrationsbetriebsnetzwerk Pflanzenschutzmittelreduktion‘ zeigen sich Demonstrationsbetriebe als wirksames Instrument bei der Umsetzung der Reduktionsziele“, betonte Hauk.
Die konsequente Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes sei die Basis und der erste Schritt, um Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. „Eine anspruchsvolle Aufgabe, die ständig betriebsindividuelle Anpassungen an wechselnde Bedingungen erfordere“, sagte der Minister und betonte, dass „so vielfältig die Reduktionsmöglichkeiten sind, so individuell müssen unsere Landwirte die Maßnahmen auf ihren Betrieb abstimmen. Ebenso wie der Standort hat das Wetter einen sehr entscheidenden Einfluss. Unsere Landwirte tragen damit eine große Verantwortung und füllen diese auch aus.“
Forschung und Beratung sind von zentraler Bedeutung
Forschung und Beratung sind von zentraler Bedeutung, um die Reduktion der Pflanzenschutzmittel weiter voranzutreiben. Zudem sind bestehende Anreize und Förderungen weiterzuentwickeln. Hierzu gehören beispielsweise die Ausweitung des Ökolandbaus, der verbesserte Wissenstransfer und schließlich Fortschritte in der Züchtung sowie in der Entwicklung neuer nicht-chemischer Verfahren im Pflanzenschutz.
„Der fortschreitende Klimawandel könnte allerdings das Ziel, die Aufwandsmenge an Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren, gefährden. Neue Schaderreger und Pflanzenkrankheiten sowie Jahre mit nasser Witterung und daraus resultierenden Pilzerkrankungen erfordern wirksame Gegenmaßnahmen, um die Ernährung und Versorgung zu sichern“, betonte Hauk.
Ergänzt wird der Bericht um einen weiteren Berichtsteil zu ‚Strategien der Gesunderhaltung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen im ökologischen Anbau‘ der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Anbau Baden-Württemberg. In dieser Anbauform werden keine chemisch-synthetischen, sondern nur in einigen Kulturen Pflanzenschutzmittel angewendet, die auf einer EU-anerkannten Positivliste stehen.
Den ausführlichen Bericht zur Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel in Baden-Württemberg 2024 finden Sie unter: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/publikation/did/bericht-zur-anwendung-chemisch-synthetischer-pflanzenschutzmittel-in-baden-wuerttemberg-2024
Die Kurzfassung des Berichtes finden Sie unter: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Landwirtschaft/2024-psm-bericht-kurzfassung.pdf
Der Bericht zur Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel in Baden-Württemberg bezieht alle Bereiche ein, in denen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angewendet werden. Neben der Landwirtschaft zählen dazu auch der Wald, Verkehrswege, öffentliches Grün und die Haus- und Kleingärten. Insgesamt werden anhand von Erhebungen mittels des Betriebsmessnetzes, Ableitungen und vereinfachten Schätzungen als mehrjähriger Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2019 rund 2200 Tonnen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittelwirkstoffe jährlich im Land ausgebracht. Eine Reduktion um 40 bis 50 % bis 2030 bedeutet einen Rückgang um rund 1000 Tonnen.
Im „Demonstrationsbetriebsnetzwerk Pflanzenschutzmittelreduktion“ erarbeiten, diskutieren, verbessern und etablieren mittlerweile 40 Demonstrationsbetriebe mit unterschiedlichen Produktionsschwerpunkten (Ackerbau, Obstbau, Weinbau, Gemüsebau) praxisrelevante Maßnahmen zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Die besonders zu Beginn des Prozesses intensiv von der Landwirtschaftsverwaltung betreuten Betriebe bilden einen wesentlichen Baustein zur Umsetzung der Reduktionsziele in der Landwirtschaft.
Durch angewandte Forschung und Entwicklung der landwirtschaftlichen Landesanstalten und weiteren Forschungseinrichtungen werden neue Verfahren bereitgestellt. Dazu gehören zum Beispiel: pilzwiderstandsfähige Sorten im Wein-, Obst- und Getreidebau, welche die Anzahl der Fungizidbehandlungen beträchtlich senken, neue digitale Techniken zur mechanischen Unkrautbekämpfung, die sich weiter in der Praxis verbreiten müssen; Prognosemodelle, die durch Forschung zur Epidemiologie und laufende Validierung in der Praxis weiterentwickelt und treffsicherer gemacht werden.




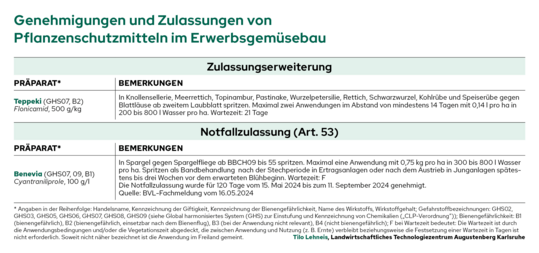





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.