
Entwicklung einer nachhaltigen Regulierungsstrategie gegen Baumwanzen
In Bayern verbreiten sich schädliche Baumwanzen, besonders die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys), die durch ihre Mobilität und breites Wirtspflanzenspektrum ein großes Schadpotenzial hat. Das Bayerische Staatsministerium fördert ein Forschungsprojekt, das das Monitoring ausweitet, Schadbilder an Obst- und Gemüsebaukulturen dokumentiert und nachhaltige Regulierungsstrategien für den Gartenbau untersucht.
von Redaktion Quelle Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) erschienen am 12.11.2024Die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) stammt ursprünglich aus Asien und hat sich mittlerweile auch in Europa verbreitet. Sie besitzt ein breites Wirtspflanzenspektrum, das viele obst- und gemüsebauliche Kulturen umfasst. Dazu gehören unter anderem Apfel, Birne, verschiedene Beerenobstsorten, Haselnüsse, Tomaten, Paprika und Bohnen. Zierpflanzen, insbesondere Ziergehölze, werden ebenfalls häufig zur Eiablage genutzt. Schäden durch die Marmorierte Baumwanze treten sowohl an Früchten als auch an Blättern und Stängeln auf. Befallene Früchte zeigen Deformationen und Flecken und sind für die Vermarktung nicht mehr geeignet.
Erhöhtes Schadpotenzial durch Klimawandel und Ausbreitung
Angesichts des zunehmenden Ausbreitungsverhaltens der Marmorierten Baumwanze und der fortschreitenden Auswirkungen des Klimawandels ist künftig mit einem hohen Schadpotenzial dieses Schädlings in Obst- und Gemüsebaubetrieben, sowohl im Erwerbs- als auch im Freizeitgartenbau in Bayern, zu rechnen. Besonders im urbanen Bereich hat sich die Marmorierte Baumwanze bereits stark ausgebreitet. Inzwischen ist sie in ganz Bayern anzutreffen, wobei die Landeshauptstadt München als einer der Hotspots gilt.
Die Bekämpfungsmöglichkeiten der Marmorierten Baumwanze sind derzeit noch sehr begrenzt. Die verfügbaren Insektizide sind aufgrund der Biologie und Robustheit der Wanzen nicht ausreichend wirksam. Das Einnetzen von Kulturen sowie das Absammeln und Vernichten der Tiere und Eigelege sind nur für einige Kulturen geeignet und im Haus- und Kleingartenbereich praktikabel. Eine vielversprechende Bekämpfungsmethode stellt die Verwendung der Samuraiwespe (Trissolcus japonicus) dar, einer Schlupfwespenart, die die Wanzen durch Parasitierung ihrer Eigelege in Schach hält. Allerdings besteht hier noch ein erheblicher Forschungsbedarf.
Hauptziele dieses Projekts sind die Weiterführung des etablierten Monitorings, die Dokumentation von Schadbildern an wichtigen Obst- und Gemüsebaukulturen sowie die Entwicklung einer nachhaltigen Regulierungsstrategie gegen Baumwanzen im Gartenbau in Bayern.
Intensivierung des Monitorings und Erweiterung der Zusammenarbeit
Das bestehende Monitoring wird intensiviert und der Austausch mit Pflanzenschutzdiensten sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands vertieft. Ausgewählte Betriebe werden mit einbezogen, um einen umfassenden Überblick über die Verbreitung der Marmorierten Baumwanze zu erhalten. Gleichzeitig wird das Vorkommen von natürlichen Gegenspielern, sowohl heimischen als auch gebietsfremden Arten, verstärkt untersucht.
Zur Dokumentation und Unterscheidung von Schadbildern an Obst- und Gemüsebaukulturen werden sowohl Freiland- als auch Gewächshausversuche durchgeführt. In diesen Versuchen werden unter anderem Baumwanzen in sogenannten Ast-Käfigen an Bäumen in verschiedenen Stadien der Fruchtreife ausgesetzt, um die Schäden zu dokumentieren. Weitere Untersuchungen konzentrieren sich auf verschiedene Bekämpfungsmethoden, darunter der Einsatz von Nützlingen, Pheromonfallen, Attract-and-Kill-Verfahren sowie Randbehandlungen mit Pflanzenschutzmitteln.
Versuche an verschiedenen Kulturen
Im Rahmen der Versuche wurden Gewächshausuntersuchungen an Gurken, Tomaten, Paprika und Zucchini sowie Freilandversuche an Birnen durchgeführt. Bei keiner der Kulturen konnte ein Unterschied im Schadbild zwischen Nymphen und adulten Wanzen festgestellt werden. Die von Wanzen beschädigten Tomaten- und Paprikafrüchte wiesen helle, durchscheinende Stellen auf der Schale sowie weißlich-schwammiges, teils verbräuntes Fruchtfleisch unter den Einstichstellen auf. Wurden Wanzen auf Gurkentriebe gesetzt, zeigte sich ein Wachstumsstopp oder ein deutlich geringer Zuwachs, außerdem waren verdrehte Triebspitzen zu beobachten. An den Einstichstellen traten Tropfen aus, deren genaue Natur jedoch noch nicht untersucht wurde.
Auch Gurken- und Zucchinifrüchte, die unter Netzschutz gesetzt wurden, zeigten nach dem Befall durch Wanzen braune Flecken und verkümmerten. Diese Schäden traten jedoch auch bei einem Großteil der eingenetzten Kontrollpflanzen auf, weshalb hier keine abschließende Aussage zu den Schäden durch Wanzen getroffen werden konnte. In einem Gemüsebaubetrieb mit starkem Befall durch die Marmorierte Baumwanze wurden ausgeprägte Deformationen der Früchte sowie Läsionen im Fruchtfleisch beobachtet.
Birnenfrüchte zeigten nach Wanzenbefall starke Deformationen mit eingesunkenen Stellen und harten, weißlichen bis bräunlichen Verkorkungen des Fruchtfleisches unter den Einstichstellen.
Weiterführende Versuche und Forschung
Da die Anzahl der Wanzen in den Versuchen aufgrund einer hohen Mortalität stark schwankte und auch die Zahl der untersuchten Pflanzen und Varianten teilweise gering und uneinheitlich war, sollen die Versuche an den wichtigsten Kulturen wiederholt werden.
Um einen besseren Überblick über das Vorkommen der Marmorierten Baumwanze sowie anderer invasiver oder heimischer Wanzenarten in bayerischen Erwerbsanlagen zu erhalten, benötigt die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Ihre Mithilfe. Wenn Sie Wanzen in Ihrem Betrieb finden, senden Sie bitte ein Bild der Wanzen zusammen mit der Angabe des Fundorts per E-Mail oder schicken Sie ein Exemplar an die folgende Adresse: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenschutz, Arbeitsgruppe Krankheiten, Schädlinge im Gartenbau (IPS 3d), Kreuzbreite 4, 85354 Freising. Bitte verpacken Sie die Wanzen in ein bruchsicheres Behältnis (zum Beispiel eine kleine Plastikdose oder eine Streichholzschachtel). Auch Befallsschäden an Früchten können Sie der Anstalt gerne mitteilen.














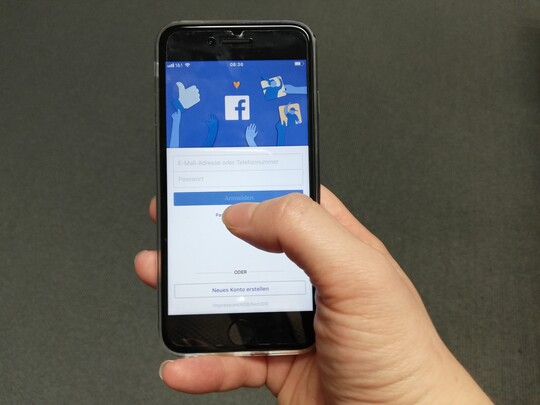




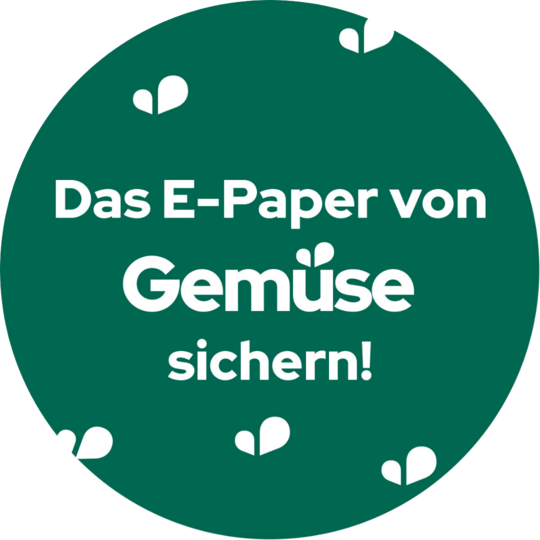
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.