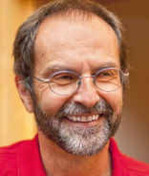Neue Anbausysteme für Spargel – Mode oder Notwendigkeit?
Die deutsche Spargelproduktion mit aktuell über 22.500 ha Gesamtfläche, davon rund 4.000 ha Junganlagen, erzielte in den letzten Dekaden durchschnittlich beachtliche Wachstumsraten und zählt zweifelsfrei mit zu den technisch und betriebsorganisatorisch besonders innovativen Produktionsbereichen in der Gemüsebranche.
- Veröffentlicht am
Jahre mit intensiver Flächenexpansion wurden etwa nach 2007 durch neue Trends abgelöst.
Im Blickpunkt stehen einmal die deutliche Verjüngung des durchschnittlichen Anlagenalters und ein verstärkter Einsatz von Doppel- und Dreifachfolienbedeckungen zur extremen Verfrühung.
Zum anderen wird die Optimierung der Ernteverspätung zur Angebotssicherung bis zum traditionellen Stechende am 24. Juni zunehmend wichtiger.
Ein noch früheres Angebot durch die Produktion von Spargel mit Heizung in Deutschland ist und bleibt dagegen umstritten.
Ein extremer CO2-Fußabdruck, steigende Energiekosten durch früheren Heizbeginn, eine schwierige Logistik und mangelnde Akzeptanz beim preisund saisonbewussten Verbraucher und Großabnehmer setzen hier enge Grenzen.
Neben einer Verlängerung des Angebotszeitraums konzentriert man sich auf weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Flächenproduktivität durch neue Anbausysteme. Das über viele Jahre dominierende Kronenpflanzsystem bekommt vielleicht eine ernstzunehmende Konkurrenz. Der Anbauer kaufte bisher die einjährigen Jungpflanzen in spezialisierten deutschen oder niederländischen Vermehrungsbetrieben. Trotz eines beachtlichen Qualitätssicherungssystems (Bodenvortests auf Wurzel-Fusarium-Arten, begleitende Feld- und Pflanzenkontrollen) in vielen Vermehrungsbetrieben gibt es immer wieder Pro-bleme mit der Wüchsigkeit von Neuanlagen. Wurden die Jungpflanzen gepflanzt, dann ist es schwer, die Ursache ausfindig zu machen. War es der Produzent, der Standort (Nachbau, Pflegefehler …), eine falsche Lagerung oder doch die Herkunft? Vermehrer, die jedes Jahr aufs Neue zu 100% jungfräuliche Böden für die Spargelanzucht zur Verfügung haben, sind wohl eher die Ausnahme.
Auch äußerlich noch einwandfreie Jungpflanzen können systemisch zum Beispiel mit Fusarium- oder Phytophthora-Pilzen infiziert sein, wie Befunde in den Diagnoselabors belegen. Auch kennen wir den jeweiligen Virusstatus der im Freiland angezogenen Sämlingspflanzen nicht.
Sehr interessant sind jedoch mehrjährige Vergleichspflanzungen unterschiedlicher Herkünfte der gleichen Spargelsorte und bei identischer Pflege auf einem Feld. Es erstaunt, welch großen Einfluss die Jungpflanzenherkunft auf die Wüchsigkeit einer Neuanlage nehmen kann. Solche unwüchsigen Spargel-Junganlagen regen Betriebsleiter, Berater und Versuchsansteller naturgemäß an, zunehmend alternative Pflanzsysteme zu prüfen.
In anderen Ländern (USA, Peru usw.) sind Kleinballensysteme – häufig aus Kostengründen – das Standardsystem. Große Hoffnungen setzt man seit wenigen Jahren auf das im Gemüsebau gängige Erdpresstopf (EPT)-System. Hochkeimfähiges Saatgut in Verbindung mit hygienisch unbedenklichem Torfsubstrat im 4- oder 5-cm-EPT und einer acht- bis zehnwöchigen Anzucht im Gewächshaus bringt kleine, aber sehr gesunde Jungpflanzen hervor. Mit behutsamer Anwachspflege (Tropfbewässerung, Fertigation) von gut abgehärteten, maschinell oder von Hand gepflanzten EPT-Jungpflanzen gelingt schon im Pflanzjahr und im folgendem Wartejahr (keine Ernte) häufig ein erstaunlicher Aufwuchs.
Wirklich neu ist diese Methode für Spargel nun auch wieder nicht. Es gibt hierzu einen Versuchsbericht (Quelle: Versuche im dt. Gartenbau, 8. Jahrg., 1996, Seite 190) über die EPT-Anzucht von Grünspargelsorten im Vergleich zu Kronenpflanzen.
Diese „alten“ Ergebnisse legen nahe, weitere derzeit in der Startphase befindlichen Exaktversuche doch noch abzuwarten. Denn wie das Jahr 2011 gezeigt hat, verlaufen solche Methodenänderungen in der breiten Praxis nicht (Wildschaden, Phytotoxizität durch UV-Strahlung oder Herbizide …).
Für eine Dauerkultur wie „Spargel“ empfiehlt es sich, neue Anbausysteme unbedingt statistisch korrekt und ausreichend lange zu prüfen.
Im Blickpunkt stehen einmal die deutliche Verjüngung des durchschnittlichen Anlagenalters und ein verstärkter Einsatz von Doppel- und Dreifachfolienbedeckungen zur extremen Verfrühung.
Zum anderen wird die Optimierung der Ernteverspätung zur Angebotssicherung bis zum traditionellen Stechende am 24. Juni zunehmend wichtiger.
Ein noch früheres Angebot durch die Produktion von Spargel mit Heizung in Deutschland ist und bleibt dagegen umstritten.
Ein extremer CO2-Fußabdruck, steigende Energiekosten durch früheren Heizbeginn, eine schwierige Logistik und mangelnde Akzeptanz beim preisund saisonbewussten Verbraucher und Großabnehmer setzen hier enge Grenzen.
Neben einer Verlängerung des Angebotszeitraums konzentriert man sich auf weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Flächenproduktivität durch neue Anbausysteme. Das über viele Jahre dominierende Kronenpflanzsystem bekommt vielleicht eine ernstzunehmende Konkurrenz. Der Anbauer kaufte bisher die einjährigen Jungpflanzen in spezialisierten deutschen oder niederländischen Vermehrungsbetrieben. Trotz eines beachtlichen Qualitätssicherungssystems (Bodenvortests auf Wurzel-Fusarium-Arten, begleitende Feld- und Pflanzenkontrollen) in vielen Vermehrungsbetrieben gibt es immer wieder Pro-bleme mit der Wüchsigkeit von Neuanlagen. Wurden die Jungpflanzen gepflanzt, dann ist es schwer, die Ursache ausfindig zu machen. War es der Produzent, der Standort (Nachbau, Pflegefehler …), eine falsche Lagerung oder doch die Herkunft? Vermehrer, die jedes Jahr aufs Neue zu 100% jungfräuliche Böden für die Spargelanzucht zur Verfügung haben, sind wohl eher die Ausnahme.
Auch äußerlich noch einwandfreie Jungpflanzen können systemisch zum Beispiel mit Fusarium- oder Phytophthora-Pilzen infiziert sein, wie Befunde in den Diagnoselabors belegen. Auch kennen wir den jeweiligen Virusstatus der im Freiland angezogenen Sämlingspflanzen nicht.
Sehr interessant sind jedoch mehrjährige Vergleichspflanzungen unterschiedlicher Herkünfte der gleichen Spargelsorte und bei identischer Pflege auf einem Feld. Es erstaunt, welch großen Einfluss die Jungpflanzenherkunft auf die Wüchsigkeit einer Neuanlage nehmen kann. Solche unwüchsigen Spargel-Junganlagen regen Betriebsleiter, Berater und Versuchsansteller naturgemäß an, zunehmend alternative Pflanzsysteme zu prüfen.
In anderen Ländern (USA, Peru usw.) sind Kleinballensysteme – häufig aus Kostengründen – das Standardsystem. Große Hoffnungen setzt man seit wenigen Jahren auf das im Gemüsebau gängige Erdpresstopf (EPT)-System. Hochkeimfähiges Saatgut in Verbindung mit hygienisch unbedenklichem Torfsubstrat im 4- oder 5-cm-EPT und einer acht- bis zehnwöchigen Anzucht im Gewächshaus bringt kleine, aber sehr gesunde Jungpflanzen hervor. Mit behutsamer Anwachspflege (Tropfbewässerung, Fertigation) von gut abgehärteten, maschinell oder von Hand gepflanzten EPT-Jungpflanzen gelingt schon im Pflanzjahr und im folgendem Wartejahr (keine Ernte) häufig ein erstaunlicher Aufwuchs.
Wirklich neu ist diese Methode für Spargel nun auch wieder nicht. Es gibt hierzu einen Versuchsbericht (Quelle: Versuche im dt. Gartenbau, 8. Jahrg., 1996, Seite 190) über die EPT-Anzucht von Grünspargelsorten im Vergleich zu Kronenpflanzen.
Diese „alten“ Ergebnisse legen nahe, weitere derzeit in der Startphase befindlichen Exaktversuche doch noch abzuwarten. Denn wie das Jahr 2011 gezeigt hat, verlaufen solche Methodenänderungen in der breiten Praxis nicht (Wildschaden, Phytotoxizität durch UV-Strahlung oder Herbizide …).
Für eine Dauerkultur wie „Spargel“ empfiehlt es sich, neue Anbausysteme unbedingt statistisch korrekt und ausreichend lange zu prüfen.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen