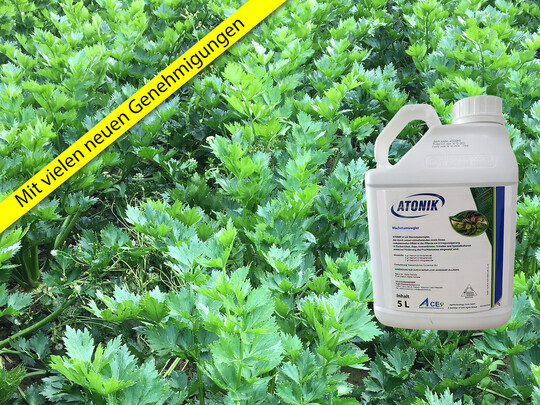Zeitreisen mal anders
Die jüngste Jahrestagung der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen Gesellschaft (DGG) machte ihrem Namen alle Ehre. Denn sie ist vor allem eines: wissenschaftlich bis über die Ohren.
- Veröffentlicht am
Die Veranstaltung fand Ende Februar statt und heißt ausgeschrieben „46. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen Gesellschaft (DGG) und des Bundesverbandes der Hochschulabsolventen/Ingenieure in Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. (BHGL)“. Uff ..., dieser Titel erfordert schon beim Lesen viel Durchhaltevermögen!
In diesem Jahr erhielten die Teilnehmer und Gäste die Tagungsunterlagen standesgemäß im „Grünen Saal“ des Hohenheimer Schlosses, das als Tagungsort angegeben war. Ab da beginnt die Zeitreise.
Von wenigen Schildern und dem Herdentrieb geleitet – leider wurde keine Zeitmaschine mit Zieleingabe zur Verfügung gestellt –, galt es den Raum der Eröffungsveranstaltung zu finden, den Hörsaal B2.
Da war sie wieder, die gute alte Studienzeit. Betonambiente der 1970er- Jahre, unbequeme Klappstühle, Enge. Wohin mit dem Mantel? Jeder moderne Schlepperbietet mehr Komfort.
Wer frühzeitig kam, um bei einer Tasse Kaffee Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen, wurde enttäuscht. Den Kaffee musste man sich erst verdienen – wieder mit gutem Durchhalten. Der ermüdende Weg führte über die (ursprünglich) halbstündige Eröffnung und die zweistündige Plenumsveranstaltung, die mir jedoch den „Gartenbau im internationalen Kontext“ nicht wirklich näher gebracht hat.
So weit, so gut. Von Wissenschaftlern kann man doch erwarten, dass sie die Inhalte ihrer Versuchsergebnisse für jeden verständlich „rüberbringen“?
Wieder Fehlanzeige! Die Vorträge waren unstrukturiert, die „Folien“ so textbeladen, dass man nicht wusste, wohin man schauen sollte. Unterhaltsam waren einzig die zahlreichen Trojanermeldungen des Virusprogramms, die beim Starten eines jeden Vortrags über die Leinwand galoppierten.
Ärgerlich zudem, dass die Vorträge mit einer halben Stunde Verspätung starteten. Anstatt die Entstehung und Entwicklung der Universität Hohenheim zu schildern, wäre eine Erläuterung des Tagungsprogrammes und der Themenauswahl interessant gewesen.
Und natürlich braucht es seine Zeit, die anwesenden Größen der Gartenbauwissenschaft von jedem der Grußwortsprecher mit Funktion und vollem Namen ihrer Institute gebührend zu begrüßen und für ihr Kommen zu danken. Vielleicht hätte man eher am Ende der Veranstaltung den noch Anwesenden für ihr Bleiben danken sollen.
Ehrlich gesagt, nach diesem Einstieg war mir als Newcomer die Lust auf diese wissenschaftlichen Tiefen des Gartenbaus vergangen. Doch durch mein Fernbleiben hätte ich zumindest den Referenten der Fachbeiträge an den folgenden zwei Tagen Unrecht getan – und Zeitreisen in die Zukunft verpasst.
In Kurzvorträgen mit einer geplanten und tatsächlichen Länge von 15 Minuten stellten die Referenten, so gut es die Zeit zuließ, den Kern ihrer Forschungsarbeit vor.
Forschung wofür? Zum Selbstzweck der Forschung oder zu irgendjemandes Nutzen, der Gemüsebauer in der Praxis etwa?
Im Wesentlichen diente diese Tagung dem wissenschaftlichen Austausch.
Selbst die wenigen Themen, denen man einen gewissen Praxisbezug zuschreiben konnte, werden in naher Zukunft für Produzenten keine Bedeutung haben. Kann das so bleiben in Zeiten knapper Finanzen und in Zeiten, in denen die Erhaltung des Gemüsebaus in diesem Land häufig überhaupt fraglich erscheint?
Freilich mag es interessant sein, zu sehen, was in der Forschung so passiert. Da werden ganze Gurkenbestände in aufwändigen Computermodellen simuliert und mit echten verglichen, um zu sehen, ob bei simulierten Kulturbedingungen Reaktionen wie in einem echten Gurkenbestand hervorgerufen werden können.
Praktisch, wenn man alternative Kulturstrategien zunächst an digitalen Versuchsobjekten ausprobieren kann.
Interessant zu sehen, dass es möglich ist, gartenbauliche Produkte per Laser mit einem Code zu versehen, der eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Problem: Die Codes sind bisher höchstens eine Woche lesbar.
Wird der Code stärker „eingebrannt“, leidet das pflanzliche Material. Ungünstig auch die natürliche Unebenheit von Äpfeln etwa. Vielleicht lässt sich da ja züchterisch noch was machen.
Dafür ist jetzt wissenschaftlich belegt, dass das Wässern von Bleichspargel tatsächlich unerwünschter Rotfärbung vorbeugt, ohne dem Produkt zu schaden.
Woran das genau liegt, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt.
Eine Reise in die Vergangenheit erspare ich Ihnen. Die Möglichkeit einer kleinen Zeitreise in die Zukunft des Gemüsebaus wird Ihnen in der Mai-Ausgabe von Gemüse geboten, in einem Bericht über „gemüserelevante“ Tagungsbeiträge.
In diesem Jahr erhielten die Teilnehmer und Gäste die Tagungsunterlagen standesgemäß im „Grünen Saal“ des Hohenheimer Schlosses, das als Tagungsort angegeben war. Ab da beginnt die Zeitreise.
Von wenigen Schildern und dem Herdentrieb geleitet – leider wurde keine Zeitmaschine mit Zieleingabe zur Verfügung gestellt –, galt es den Raum der Eröffungsveranstaltung zu finden, den Hörsaal B2.
Da war sie wieder, die gute alte Studienzeit. Betonambiente der 1970er- Jahre, unbequeme Klappstühle, Enge. Wohin mit dem Mantel? Jeder moderne Schlepperbietet mehr Komfort.
Wer frühzeitig kam, um bei einer Tasse Kaffee Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen, wurde enttäuscht. Den Kaffee musste man sich erst verdienen – wieder mit gutem Durchhalten. Der ermüdende Weg führte über die (ursprünglich) halbstündige Eröffnung und die zweistündige Plenumsveranstaltung, die mir jedoch den „Gartenbau im internationalen Kontext“ nicht wirklich näher gebracht hat.
So weit, so gut. Von Wissenschaftlern kann man doch erwarten, dass sie die Inhalte ihrer Versuchsergebnisse für jeden verständlich „rüberbringen“?
Wieder Fehlanzeige! Die Vorträge waren unstrukturiert, die „Folien“ so textbeladen, dass man nicht wusste, wohin man schauen sollte. Unterhaltsam waren einzig die zahlreichen Trojanermeldungen des Virusprogramms, die beim Starten eines jeden Vortrags über die Leinwand galoppierten.
Ärgerlich zudem, dass die Vorträge mit einer halben Stunde Verspätung starteten. Anstatt die Entstehung und Entwicklung der Universität Hohenheim zu schildern, wäre eine Erläuterung des Tagungsprogrammes und der Themenauswahl interessant gewesen.
Und natürlich braucht es seine Zeit, die anwesenden Größen der Gartenbauwissenschaft von jedem der Grußwortsprecher mit Funktion und vollem Namen ihrer Institute gebührend zu begrüßen und für ihr Kommen zu danken. Vielleicht hätte man eher am Ende der Veranstaltung den noch Anwesenden für ihr Bleiben danken sollen.
Ehrlich gesagt, nach diesem Einstieg war mir als Newcomer die Lust auf diese wissenschaftlichen Tiefen des Gartenbaus vergangen. Doch durch mein Fernbleiben hätte ich zumindest den Referenten der Fachbeiträge an den folgenden zwei Tagen Unrecht getan – und Zeitreisen in die Zukunft verpasst.
In Kurzvorträgen mit einer geplanten und tatsächlichen Länge von 15 Minuten stellten die Referenten, so gut es die Zeit zuließ, den Kern ihrer Forschungsarbeit vor.
Forschung wofür? Zum Selbstzweck der Forschung oder zu irgendjemandes Nutzen, der Gemüsebauer in der Praxis etwa?
Im Wesentlichen diente diese Tagung dem wissenschaftlichen Austausch.
Selbst die wenigen Themen, denen man einen gewissen Praxisbezug zuschreiben konnte, werden in naher Zukunft für Produzenten keine Bedeutung haben. Kann das so bleiben in Zeiten knapper Finanzen und in Zeiten, in denen die Erhaltung des Gemüsebaus in diesem Land häufig überhaupt fraglich erscheint?
Freilich mag es interessant sein, zu sehen, was in der Forschung so passiert. Da werden ganze Gurkenbestände in aufwändigen Computermodellen simuliert und mit echten verglichen, um zu sehen, ob bei simulierten Kulturbedingungen Reaktionen wie in einem echten Gurkenbestand hervorgerufen werden können.
Praktisch, wenn man alternative Kulturstrategien zunächst an digitalen Versuchsobjekten ausprobieren kann.
Interessant zu sehen, dass es möglich ist, gartenbauliche Produkte per Laser mit einem Code zu versehen, der eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Problem: Die Codes sind bisher höchstens eine Woche lesbar.
Wird der Code stärker „eingebrannt“, leidet das pflanzliche Material. Ungünstig auch die natürliche Unebenheit von Äpfeln etwa. Vielleicht lässt sich da ja züchterisch noch was machen.
Dafür ist jetzt wissenschaftlich belegt, dass das Wässern von Bleichspargel tatsächlich unerwünschter Rotfärbung vorbeugt, ohne dem Produkt zu schaden.
Woran das genau liegt, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt.
Eine Reise in die Vergangenheit erspare ich Ihnen. Die Möglichkeit einer kleinen Zeitreise in die Zukunft des Gemüsebaus wird Ihnen in der Mai-Ausgabe von Gemüse geboten, in einem Bericht über „gemüserelevante“ Tagungsbeiträge.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen