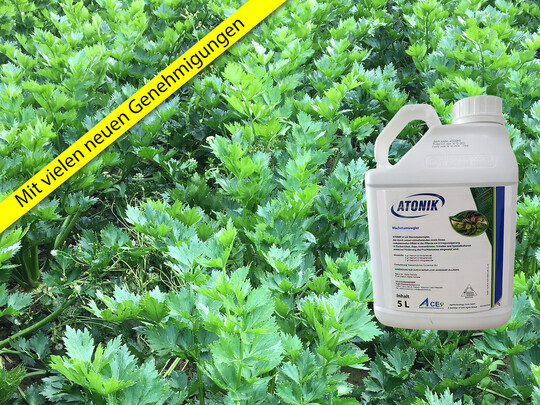Konsequenzen des „Hofladenurteils“
Zu den Auswirkungen des Hofladenurteils und den Neuregelungen zur Abgrenzung von Land- und Forstwirtschaft zum Gewerbe bei Handelsgeschäften wurde auf Seite 8 ein Beispiel gegeben.
- Veröffentlicht am
Bei unterstellten 100 % Aufschlag (was das Rechnen so schön einfach macht) wäre also de facto in dem Beispiel nur noch ein Zukauf in Höhe von 25.750,00 € zulässig, damit das Handelsgeschäft beziehungsweise der Hofladen dieses Gemüsebaubetriebs landwirtschaftlich bleibt.
Arbeitet der Betrieb mit etwa 30 % Aufschlag, wäre ein Zukauf von rund 40.000,00 € zulässig, um diese 51.500,00 €-Grenze einzuhalten. Das bedeutet für diesen Betrieb, dass der Zukauf von bisher 300.000,00 € auf maximal 40.000,00 € sinkt.
Die bisherige Unterscheidung von betriebstypischem und atypischem Zukauf dürfte im Gemüsebau keine Bedeutung gehabt haben. Dabei wurden rein gewerbliche Produkte wie zum Beispiel Übertöpfe in Gärtnereien nochmals gesondert beurteilt. Sollten in einem Hofladen derartige Gegenstände verkauft werden, ist diese Unterscheidung jedenfalls nicht mehr bedeutend.
Bei kontinuierlicher Betriebsentwicklung und vorheriger Nichtüberschreitung der alten Umsatzgrenze ist immerhin positiv, dass die Finanzverwaltung die neuen Begrenzungen erst im Rahmen der Grundsätze des Strukturwandels anwenden will.
Dies bedeutet, dass die neuen Grenzen drei Jahre lang fortlaufend überschritten sein müssen, um danach gewerblich eingestuft zu werden. Bei abweichendem Wirtschaftsjahr kann also noch abgewartet werden, ob der Betrieb diese Grenze in den Jahren 2010/2011, 2011/2012 und 2012/2013 überschreitet. Danach wäre die Gewerblichkeit des Zukaufs ab dem Wirtschaftsjahr 2013/2014 in jedem Fall gegeben.
Wirkt sich das auch auf die Eigenproduktion aus?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil einen Hofladen untersucht und festgestellt, dass seines Erachtens bei Überschreiten dieser Grenzen der Hofladen als solcher insgesamt gewerblich wäre. Das betrifft auch die dort veräußerten Eigenprodukte.
Bei einem Gemüsebaubetrieb werden aber in den seltensten Fällen alle Produkte über den eigenen Hofladen veräußert werden.
Leider hat sich die Finanzverwaltung nicht auf das Drängen der Verbände eingelassen und in dem BMF-Schreiben genauer festgelegt, wie sich das auf die übrigen Absatzwege auswirkt.
Der BFH hat als solcher jedoch in seinem Urteil ausdrücklich festgestellt, dass neben dem gewerblichen Hofladen eine landwirtschaftliche Produktion und Vermarktung im selben Betrieb vorliegen kann.
Im Gemüsebau könnten hier die Vermarktungswege Wochenmarkt, Genossenschaft, Großhandel, Abo-Kisten oder auch, wie besonders häufig bei Spargel und Erdbeeren, mobile Vermarktungseinrichtungen am Straßenrand gegeben sein.
Handelt ein Betrieb, setzt er nach aller Erfahrung auch nach dem Wochenmarkt und möglicherweise auch in den mobilen Vermarktungseinrichtungen Handelsware ab. Die übrige Produktion, die über Großhandelswege abgesetzt wird, müsste aber nach dem Urteil des BFH im selben Betrieb weiterhin landwirtschaftlich bleiben können.
Wie sollte man weiter vorgehen? Wie gesagt, gelten die Grundsätze des Strukturwandels für einen Dreijahreszeitraum. Erst danach droht dann die Einstufung als gewerblich.
Außerordentliche Maßnahmen können dabei aber auch bisher schon zur sofortigen Gewerblichkeit führen. Ob hierunter zum Beispiel der Bau größerer Vermarktungseinrichtungen zu verstehen ist, müsste mit der Finanzverwaltung noch abgeklärt werden.
Die Berater gehen unter Anwendung von Abschnitt 15.5, Absatz 1, Satz 7 EStR davon aus, dass diese Übergangsfrist des Strukturwandels auch für landwirtschaftliche Personengesellschaften greift.
Das wären Betriebe, die in den Rechtsformen der GdbR, OHG oder KG geführt werden. Unstrittig ist aber für diese Betriebe, dass nach Ablauf der Strukturwandelsphase keine Unterscheidung mehr für einzelne Absatzwege greift, sondern der Gesamtbetrieb gewerblich wird. Steuerlich nennt man dies „Durchsäuerungstheorie“.
Die Konsequenzen der Gewerblichkeit sind vielfältig und treffen die Betrieb in unterschiedlicher Härte. Um den Rahmen dieses Kommentars nicht zu sprengen, soll dies in einem Folgebeitrag für den Gemüsebau in Gemüse Nr. 4/ 2010 dargestellt werden.
Ausdrücklich sei aber darauf hingewiesen, dass die Finanzverwaltung in einem anderen BMF-Schreiben die geänderte Rechtssprechung des BFH zur Umsatzsteuerpauschalierung innerhalb gewerblicher Betriebe übernommen hat.
Die ertragsteuerliche Gewerblichkeit hat also nichts mit der Frage zu tun, ob der Betrieb umsatzsteuerlich noch pauschalieren kann. Dies ist auch für einen Hofladen noch weiterhin hinsichtlich der selbst erzeugten Produkte möglich, für Handelswaren bereits seit 1. Juli 2008 nicht mehr.
Arbeitet der Betrieb mit etwa 30 % Aufschlag, wäre ein Zukauf von rund 40.000,00 € zulässig, um diese 51.500,00 €-Grenze einzuhalten. Das bedeutet für diesen Betrieb, dass der Zukauf von bisher 300.000,00 € auf maximal 40.000,00 € sinkt.
Die bisherige Unterscheidung von betriebstypischem und atypischem Zukauf dürfte im Gemüsebau keine Bedeutung gehabt haben. Dabei wurden rein gewerbliche Produkte wie zum Beispiel Übertöpfe in Gärtnereien nochmals gesondert beurteilt. Sollten in einem Hofladen derartige Gegenstände verkauft werden, ist diese Unterscheidung jedenfalls nicht mehr bedeutend.
Bei kontinuierlicher Betriebsentwicklung und vorheriger Nichtüberschreitung der alten Umsatzgrenze ist immerhin positiv, dass die Finanzverwaltung die neuen Begrenzungen erst im Rahmen der Grundsätze des Strukturwandels anwenden will.
Dies bedeutet, dass die neuen Grenzen drei Jahre lang fortlaufend überschritten sein müssen, um danach gewerblich eingestuft zu werden. Bei abweichendem Wirtschaftsjahr kann also noch abgewartet werden, ob der Betrieb diese Grenze in den Jahren 2010/2011, 2011/2012 und 2012/2013 überschreitet. Danach wäre die Gewerblichkeit des Zukaufs ab dem Wirtschaftsjahr 2013/2014 in jedem Fall gegeben.
Wirkt sich das auch auf die Eigenproduktion aus?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil einen Hofladen untersucht und festgestellt, dass seines Erachtens bei Überschreiten dieser Grenzen der Hofladen als solcher insgesamt gewerblich wäre. Das betrifft auch die dort veräußerten Eigenprodukte.
Bei einem Gemüsebaubetrieb werden aber in den seltensten Fällen alle Produkte über den eigenen Hofladen veräußert werden.
Leider hat sich die Finanzverwaltung nicht auf das Drängen der Verbände eingelassen und in dem BMF-Schreiben genauer festgelegt, wie sich das auf die übrigen Absatzwege auswirkt.
Der BFH hat als solcher jedoch in seinem Urteil ausdrücklich festgestellt, dass neben dem gewerblichen Hofladen eine landwirtschaftliche Produktion und Vermarktung im selben Betrieb vorliegen kann.
Im Gemüsebau könnten hier die Vermarktungswege Wochenmarkt, Genossenschaft, Großhandel, Abo-Kisten oder auch, wie besonders häufig bei Spargel und Erdbeeren, mobile Vermarktungseinrichtungen am Straßenrand gegeben sein.
Handelt ein Betrieb, setzt er nach aller Erfahrung auch nach dem Wochenmarkt und möglicherweise auch in den mobilen Vermarktungseinrichtungen Handelsware ab. Die übrige Produktion, die über Großhandelswege abgesetzt wird, müsste aber nach dem Urteil des BFH im selben Betrieb weiterhin landwirtschaftlich bleiben können.
Wie sollte man weiter vorgehen? Wie gesagt, gelten die Grundsätze des Strukturwandels für einen Dreijahreszeitraum. Erst danach droht dann die Einstufung als gewerblich.
Außerordentliche Maßnahmen können dabei aber auch bisher schon zur sofortigen Gewerblichkeit führen. Ob hierunter zum Beispiel der Bau größerer Vermarktungseinrichtungen zu verstehen ist, müsste mit der Finanzverwaltung noch abgeklärt werden.
Die Berater gehen unter Anwendung von Abschnitt 15.5, Absatz 1, Satz 7 EStR davon aus, dass diese Übergangsfrist des Strukturwandels auch für landwirtschaftliche Personengesellschaften greift.
Das wären Betriebe, die in den Rechtsformen der GdbR, OHG oder KG geführt werden. Unstrittig ist aber für diese Betriebe, dass nach Ablauf der Strukturwandelsphase keine Unterscheidung mehr für einzelne Absatzwege greift, sondern der Gesamtbetrieb gewerblich wird. Steuerlich nennt man dies „Durchsäuerungstheorie“.
Die Konsequenzen der Gewerblichkeit sind vielfältig und treffen die Betrieb in unterschiedlicher Härte. Um den Rahmen dieses Kommentars nicht zu sprengen, soll dies in einem Folgebeitrag für den Gemüsebau in Gemüse Nr. 4/ 2010 dargestellt werden.
Ausdrücklich sei aber darauf hingewiesen, dass die Finanzverwaltung in einem anderen BMF-Schreiben die geänderte Rechtssprechung des BFH zur Umsatzsteuerpauschalierung innerhalb gewerblicher Betriebe übernommen hat.
Die ertragsteuerliche Gewerblichkeit hat also nichts mit der Frage zu tun, ob der Betrieb umsatzsteuerlich noch pauschalieren kann. Dies ist auch für einen Hofladen noch weiterhin hinsichtlich der selbst erzeugten Produkte möglich, für Handelswaren bereits seit 1. Juli 2008 nicht mehr.
Mehr zum Thema:
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen