Gemüse: Welches Schlagwort kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an den Pflanzenschutz im Gemüsebau im Jahr 2034 denken?
„Totgesagte leben länger“ – weil viele Pessimisten immer davon reden, dass in den nächsten Jahren kein chemischer Pflanzenschutz mehr möglich ist und es somit auch keinen Gemüsebau mehr geben wird. Da glaube ich nicht dran. Ich denke, Pflanzenschutz im Gemüsebau wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie dieser aussieht. Ein Blick in die Zukunft ist schwierig. Mark Twain hat mal gesagt: „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“. Der Pflanzenschutz wird anders aussehen, aber wie, kann im Moment niemand sagen.
Dann zurück zur Gegenwart: Mit welchen Herausforderungen müssen die Anbauer aktuell im Pflanzenschutz kämpfen?
Kein Jahr ist gleich. Dadurch gibt es immer Kulturen, bei denen es schwierig ist, bestimmte Schädlinge ganzjährig zu kontrollieren. Zum Beispiel war Falscher Mehltau bei Zwiebeln dieses Jahr durch die anhaltenden Niederschläge extrem schwierig unter Kontrolle zu halten – gerade im Frühjahr. Im Sommer sah das wieder anders aus, die Situation hatte sich entspannt und man konnte diese Kultur mit weniger Behandlungen weiter kultivieren. Das Problem ist, dass circa 89 % des Obst- und Gemüseabsatzes über den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) laufen und somit viele Betriebe Lieferverpflichtungen eingehen müssen. Wenn dann essenzielle Mittel wegfallen, wird es schwierig bestimmte Kulturen ganzjährig anzubauen. Auch die Vorgaben des LEH, zum Beispiel hinsichtlich Anzahl der Wirkstoffe im Produkt, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, sind entscheidend. Dann muss ich als Anbauer damit klarkommen, dass Wirkstoffwechsel und Resistenzmanagement zunehmend schwierig werden. Kommen dann noch neu auftretende Schaderreger hinzu, die zum Teil auch neue Krankheiten mit Viren und Phytoplasmen übertragen, wird es noch schwerer.
Wie hat sich der Pflanzenschutz in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?
Wenn man 20 bis 30 Jahre zurückgeht, hatte man eine breite Mittelpalette, keine Indikationszulassung und breit wirksame Mittel. Man konnte teilweise mit zwei bis drei Mitteln eine Kultur anbauen. Mittlerweile wird zunehmend darauf geachtet, dass Nichtzielorganismen weniger beeinträchtigt werden, was auch richtig ist. So ist man mehr zu selektiven Mitteln gekommen, die spezifischer wirken. Das ist umweltschonender, aber gleichzeitig benötigen wir mehr Mittel, da die Zahl der Schaderreger ja nicht abgenommen hat. Es sind viele chemisch-synthetische Wirkstoffe auf EU-Ebene verloren gegangen, deren Zulassung widerrufen wurde oder die nicht wieder neu zugelassen wurden. Stattdessen kamen biologische Mittel auf Basis von Pilzen oder anderen Mikroorganismen hinzu, die aber in ihrer Wirksamkeit in Versuchen immer hinter den „Standardmitteln“ zurückbleiben. Die Anzahl an zugelassenen Pflanzenschutzmitteln hat sich nicht verringert, wohl aber die der effektiv wirksamen Wirkstoffe. Dadurch steigt das Anbaurisiko. Aber das führt auch dazu, dass die Betriebe die Mittel gezielter einsetzen. Beispielsweise führen sie Vorernteproben auf Rückstände durch, ob das Gemüse auch die Anforderungen des LEHs erfüllt. Da hat sich einiges getan, aber das ist alles auch mit Kostensteigerungen verbunden.
Gibt es denn auch Alternativen zu den wegfallenden Wirkstoffen?
Die Hacktechnik hat sich enorm entwickelt. Vor 15 Jahren war die Gänsefußhacke oder vielleicht noch eine Fingerhacke das Nonplusultra. Heutzutage verfügen wir über kameraunterstützte Technik, praxisreife autonome Roboter und die Wissenschaft entwickelt Lasertechnik zur Unkrautbekämpfung. Das kostet allerdings viel Geld, welches wieder reingeholt werden muss. Technik und Alternativen sind nicht das Problem, aber die Kosten dafür. Ich habe schon mal bei einem Vortrag gesagt, wir brauchen keine Herbizide, wir brauchen nur 2000 Euro pro Hektar, damit wir Saisonarbeitskräfte bezahlen können, die die Unkräuter entfernen. Es ist also eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
Welche Lösungen gibt es denn für die aktuellen Herausforderungen?
Es geht ja immer irgendwie weiter. Die Frage ist nur, wie. Sind die Lösungen auch praktikabel und bezahlbar? Die Innovationsbereitschaft und der Erfindungsreichtum der Betriebe sind wirklich groß. Viele entwickeln selbst technische Lösungen, und es ist einiges im Gange. Insektenschutznetze haben sich beispielsweise weit verbreitet. Kulturen wie Speiserübe, Rettich oder Chinakohl werden vielfach gar nicht mehr ohne Netz angebaut. Das hat viele Vorteile, obwohl es mit hohen Anschaffungskosten verbunden ist – diese amortisieren sich jedoch über ihre Lebensdauer von fünf bis zehn Jahren. Es wird vermutlich nicht für alle Kulturen Lösungen geben. Als Berater kann man gerade bei Kulturen, die nicht so relevant für die Wirkstoffzulassung sind, teilweise schon kein Mittel mehr empfehlen, den Betrieben nicht mehr weiterhelfen oder eine mögliche Lösung ist einfach zu teuer. Dann wird die Kultur eben nicht mehr angebaut, weil sie nicht mehr wirtschaftlich ist.
Woran wird aktuell wissenschaftlich gearbeitet?
In den vergangenen Jahren ist die RNA-Technik immer wieder aufgeploppt. Die Ribonukleinsäure Interferenz ist extrem selektiv, weil ich damit im Schaderreger einzelne Gene an- oder ausschalten kann, die zum Beispiel für eine Proteinbildung zuständig sind. Wenn die RNA-Technik dann in der Lage ist, nur bei diesem Schaderreger das Gen zu deaktivieren, habe ich ein sehr selektives Mittel, welches ein geringes toxikologisches Potenzial für andere Organismen hat. In den USA gibt es schon erste Zulassungen, da wir aber sehr viele RNA-Präparate brauchen dauert das noch. Ich glaube nicht, dass wir damit die Lücken schneller schließen können, als sie durch den Wegfall der Wirkstoffe auf EU-Ebene entstehen. Ich sehe darin aber schon einen weiteren Baustein für den Pflanzenschutz in der Zukunft.
Was wird in Zukunft die größte Herausforderung für den Gemüsebau sein?
Was mir etwas Kopfschmerzen bereitet, ist dieser nationale Alleingang des Zukunftsprogramms Pflanzenschutz mit der unter anderem geplanten 50 %-Reduktion bis 2030. Bevor man keine Alternativen hat, kann man nicht einfach die Mittel streichen. Da sehe ich einen Wettlauf, den man auch verlieren kann. Mit den geplanten Regelungen klarzukommen, sehe ich schon als große Herausforderung für den Gemüsebau an. Denn Gemüse soll auch kein Luxusgut werden, weil mir jeder dritte Anbausatz ausfällt und der Ausfall mitbezahlt werden muss. Das verteuert die Produktion. Auch die Lohnkosten steigen. Das kann vielleicht dazu führen, dass die ein oder andere Kultur nur noch saisonal oder gar nicht mehr abgebaut wird. Das Klima wird eine Herausforderung, mit immer mehr heißen Tagen, an denen man tagsüber keine Pflanzenschutzbehandlung machen darf. Also muss ich den Pflanzenschutz umstellen, mit mehr Wasser arbeiten oder nachts fahren, kann nicht mehr alle Mittel verwenden, da diese über bestimmten Temperaturen teilweise nicht richtig wirken oder muss andere Gemüsekulturen und -sorten anbauen, die besser mit der Hitze klarkommen. In Schifferstadt hatten wir 2023 zum Beispiel 33 Tage über 30 Grad Celsius, vor 15 Jahren waren es nur 18 Tage. Das hat natürlich einen Einfluss auf das Schädlingsaufkommen und den Pflanzenschutz.
Was wünschen Sie sich für die Gemüsebaubranche für die Zukunft?
Gemüsebau ist eine der tollsten Bereiche der Agrarwirtschaft, da er so vielfältig in den Kulturen ist. Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen gegeben sind, dass wir einen vielfältigen und regionalen Gemüseanbau haben und noch das ganze Spektrum anbauen können. Denn der Wille ist da bei den Gemüseproduzenten – man muss sie nur machen lassen.
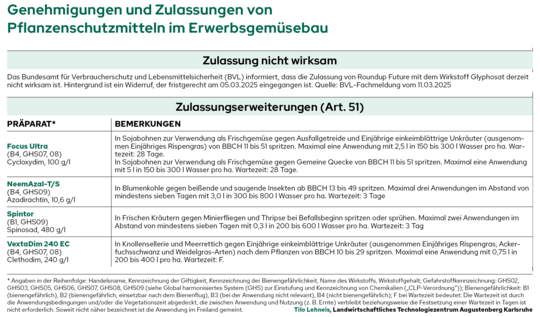







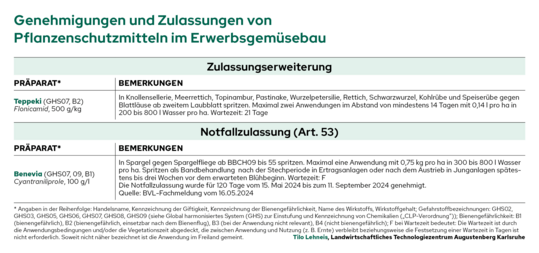



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.