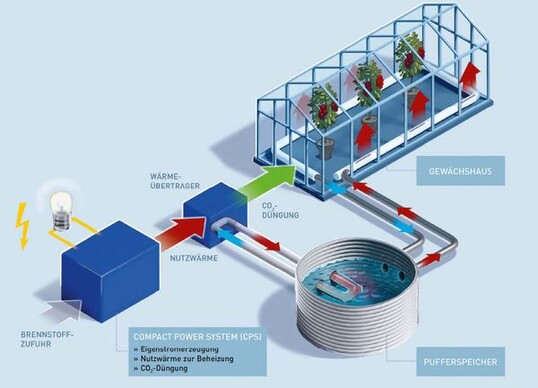
Autonome Maschinen mit großem Potenzial, Digitalisierung mit Hindernissen
Nach fünf Jahren neigt sich das Projekt Zukunftslabor Agrar (ZLA) dem Ende zu. Forschungseinrichtungen aus Niedersachsen, darunter das DFKI, untersuchten Aspekte der digitalisierten Landwirtschaft der Zukunft. Beim Konzept des Spot Farming wird ein Feld nicht als homogene Fläche betrachtet. Teile des Feldes werden, zum Erhalt der Umwelt und zur Steigerung des Ertrags, unterschiedlich bepflanzt. Für die Bewirtschaftung sollen neuartige Maschinen, wie zum Beispiel Roboter, zum Einsatz kommen.
von red Quelle Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, DFKI erschienen am 24.09.2024Spot Farming stellt die herkömmliche Denkweise in der Landwirtschaft auf den Kopf. Nutzpflanzen wie Mais oder Kartoffeln werden heute, angepasst an die Kapazitäten großer Landmaschinen, auf weitläufigen, gleichförmig behandelten Feldern angebaut. Dünger und Pflanzenschutzmittel helfen, Standortnachteile einzelner Pflanzen durch ungünstige Böden oder Lagen auszugleichen, um dennoch gute Erträge zu erzielen.
Professor Jens Wegener vom Julius Kühn-Institut entwickelte 2017 die Idee des Spot Farming mit: „In Zukunft werden die Ressourcen für eine solche pauschale Herangehensweise begrenzt sein. Auch der Klimawandel stellt den Pflanzenbau durch veränderte Wetterbedingungen vor große Herausforderungen. Das Ziel von Spot Farming ist es, verschiedene Pflanzen dort anzubauen, wo sie jeweils optimale Wachstumsbedingungen vorfinden. Dadurch werden sie widerstandsfähiger, ertragreicher und die Umwelt wird geschont.“ Die Technik müsse sich ebenfalls danach ausrichten. Dafür seien kleinere Maschinen und Roboter notwendig.
Bislang ist dieser Ansatz jedoch nur theoretisch. „Im ZLA sind wir auf dem Weg zur Realisierung von Spot Farming erhebliche Schritte weitergekommen“, so Wegener. Das Institut für Anwendungstechnik im Pflanzenschutz am Julius Kühn-Institut entwickelte im ZLA eine agrarwissenschaftliche Methode, mit der Spots mit unterschiedlichen Wachstumsbedingungen auf einem Feld anhand öffentlich zugänglicher Geodaten identifiziert werden. Zusammen mit dem DFKI wurde ein Tool entwickelt, das automatisch Feldkarten mit diesen Spots erstellt, die von Robotern bearbeitet werden können. Die TU Braunschweig baute einen Prototyp einer Universalsämaschine, die Saat in optimalen Abständen für das Pflanzenwachstum in die Erde bringt und an einem Roboter befestigt wird.
Funktionstüchtige Roboter als Grundlage
Damit Roboter später einmal die Spots auf einem Feld autonom ansteuern und bearbeiten können, müssen sie sich in ihrer Umgebung zurechtfinden. Die Technologie dafür wurde im ZLA vom Forschungsbereich Planbasierte Robotersteuerung des DFKI weiterentwickelt. Forschende erstellten eine semantische Karte mit Geo- und Umgebungsdaten eines realen Bauernhofs. Mit dieser Karte konnte ein Roboter seine Umgebung wahrnehmen, verstehen, navigieren und autonom über den Betrieb fahren. Zukünftig könnten Informationen zur Aufteilung eines Feldes beim Spot Farming ebenfalls in diese Karte einfließen.
Joachim Hertzberg, Informatikprofessor an der Universität Osnabrück und Sprecher des ZLA-Projekts, betont: „Roboter ermöglichen neue Prozesse in der Landwirtschaft. Das ZLA hat gezeigt, dass dies keine Fantasie ist. Die Technik kann beim Spot Farming in Pflanzenbauprozessen eingesetzt werden, die mit herkömmlichen Maschinen nicht realisierbar sind.“

Auch die Arbeit der Hochschule Osnabrück im Rahmen des ZLA trägt zur Zukunft des Spot Farming bei. Mithilfe eines GPS-gesteuerten Roboters wurden an verschiedenen Stellen eines Feldes automatisiert Daten zur Bodenverdichtung erhoben. In verdichteten Bereichen ist Wasser für Pflanzen schwerer verfügbar, was den Ertrag beeinträchtigen kann. Diese Informationen könnten bei der Kartierung von Spots berücksichtigt werden.
Ohne Daten keine KI und Robotik
Intelligente digitale Technologien benötigen Daten – und diese stehen nicht immer einfach zur Verfügung. Benjamin Kisliuk, Wissenschaftler am DFKI, erklärt: „Damit ein Roboter auf einem Betrieb selbstständig arbeiten kann, braucht es einen Digital Twin, also ein virtuelles Abbild der Realität. Um zu wissen, wo Feldgrenzen verlaufen, sind Geodaten nötig. Doch in manchen Bundesländern sind diese nicht leicht zugänglich. Während man sie in Nordrhein-Westfalen einfach herunterladen kann, muss man in Niedersachsen erst eine E-Mail an das Amt schreiben.“
Diese Beobachtung deckt sich mit den Erkenntnissen anderer ZLA-Projekte. Das Thünen-Institut analysierte die Datenflüsse zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und staatlichen Stellen, Veterinärämtern sowie Zertifizierungsstellen. Es zeigte sich, dass die Datenerhebung auf den Betrieben oft manuell erfolgt, zum Beispiel durch Eingaben in ein digitales Farmmanagementsystem. Die Übermittlung dieser Daten an Kontrollstellen stellt eine weitere Hürde dar, da sie auf verschiedene Arten erfolgt. Häufig werden Daten aufbewahrt, um sie bei einer Vor-Ort-Inspektion vorzuzeigen. Der Versand per Post und Fax wird ebenfalls noch oft genutzt.
Joachim Hertzberg betont: „Es gibt noch keine einheitlichen digitalen Schnittstellen für die Interaktion zwischen den Akteuren in der Landwirtschaft, doch sie sind dringend notwendig. Die Politik muss solche Schnittstellen ermöglichen, ähnlich wie bei der Steuererklärung. Landwirtinnen und Landwirte können ihre digital erfassten Daten sonst nicht effizient an Behörden übermitteln und haben unnötig viel zusätzlichen Aufwand.“
Transformation gelingt nur mit den Menschen
Die technische Transformation in der Landwirtschaft, hin zu datenbasierten KI-Anwendungen und neuen Konzepten wie dem Spot Farming, erfordert auch eine Berücksichtigung der sozialen Faktoren. Dies unterstreicht Prof. Silke Hüttel von der Georg-August-Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, im ZLA.
„Die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft notwendig. Idealerweise wird sie zum neuen Normalzustand, um Klima und Umwelt zu schützen. Gleichzeitig sind manche Menschen skeptisch und halten an bewährten Methoden fest. Wir müssen zeigen, dass digitale Technologien ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvoll sind.“
Hüttel und ihr Team befragten im ZLA Landwirte aus dem Zuckerrübenanbau in Nord- und Westdeutschland, um herauszufinden, welche Faktoren die Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft für autonome Roboter beeinflussen. Es zeigte sich, dass Landwirtinnen und Landwirte besonders dann bereit sind, Roboter einzusetzen, wenn diese zuverlässig arbeiten und keine zusätzliche Arbeit verursachen. Zudem wollen sie die Kontrolle behalten. Wenn sie mit ihrer aktuellen Arbeitsweise zufrieden sind, stehen sie neuen Technologien eher zurückhaltend gegenüber. Positive Rückmeldungen aus der Gesellschaft können ihre Einstellung zur Robotik jedoch verbessern.
Das Projekt ZLA startete im Oktober 2019 und wird im Rahmen des Zentrums für Digitale Innovationen Niedersachsen (ZDIN) mit 3,7 Millionen Euro aus dem Fonds zukunft.niedersachsen gefördert. Neben dem DFKI und der Universität Osnabrück, dem Konsortialführer, waren folgende Institutionen am Projekt beteiligt: Georg-August-Universität Göttingen, Hochschule Osnabrück, Julius Kühn-Institut, Technische Universität Braunschweig, Thünen-Institut und Universität Vechta.

















Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.