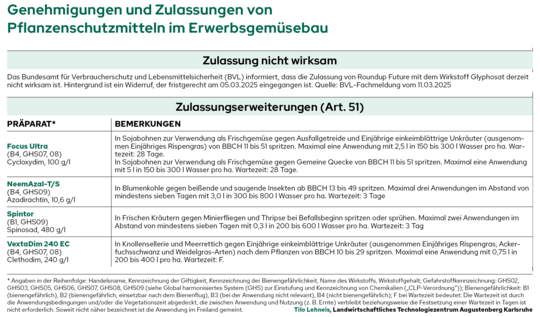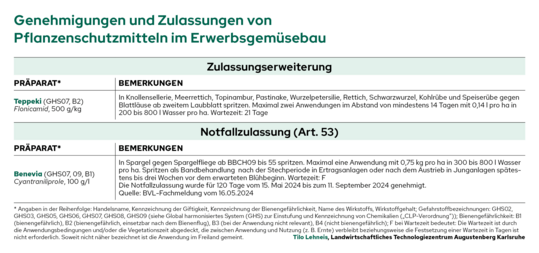Von südlichen Wurzelgallennematoden Meloidogyne incognita befallene Zucchinipflanzen
- Veröffentlicht am

In einem Freilandbestand Zucchini ‘Cucurbita pepo’ zeigten einzelne Pflanzen oberirdisch Symptome, die auf Probleme in der Wasseroder Nährstoffversorgung hinwiesen. Die Pflanzen waren vergilbt, gestaucht, hart und spröde. Ältere Blätter in Bodennähe starben ab. Unterirdisch zeigten die unregelmäßig und unförmig angeschwollenen Wurzeln dieser Pflanzen gallenartige Verdickungen. Stark geschädigte Wurzeln vermorschten und starben ab. An und in den Wurzeln der geschädigten Pflanzen wurde der Südliche Wurzelgallennematode Meloidogyne incognita nachgewiesen.
Die Schädigungen an den oberirdischen Pflanzenteilen sind auf die Probleme in der Nährstoff- und Wasseraufnahme zurückzuführen, die durch die Missbildungen der Wurzeln und die Störung der Feinwurzelbildung verursacht werden. Die Symptome treten vor allem auf leichten Böden und bei Trockenstress – wie für Nematoden typisch – nesterartig auf. Kurz hinter der Wurzelspitze, in der Zone des Streckungswachstumes dringt die Nematodenlarve in die Wurzel ein, regt das Gewebe zum Wachstum an und animiert die Pflanze zur Bildung von Nährzellgewebe, von dem sie sich ernährt.
Innerhalb der Pflanze durchläuft das Wurzelgallenälchen verschiedene Entwicklungsstadien. Im Laufe eines Vegetationszyklus treten mehrere Generationen auf. Die birnenförmig anschwellenden Weibchen leben in den Wurzeln. Sie legen bis zu 400 Eier in einem gelatinösen Eiersack ab, aus dem die Larven im L2-Stadium in die Erde auswandern. Männliche Larven entwickeln sich komplett in der Wurzel und wandern dann ebenfalls aus. Die Dauer eines Lebenszyklus von Meloidogyne incognita ist von der Kultur und der Temperatur abhängig. Bei 25 bis 30°C dauert ein Zyklus 21 bis 28 Tage.
Nur Männchen und junge Larven sind im Boden beweglich. Eier und Junglarven können im Boden bis zu zwei Jahre überleben, ohne Wirtspflanze allerdings maximal 60 Tage. Die wärmeliebenden Nematoden der Art Meloidogyne incognita sind weltweit, mit Schwerpunkt in den Tropen und Subtropen, verbreitet und können in Landwirtschaft, Zierpflanzen- und Gemüsebau große Schäden verursachen. In Deutschland ist das Vorkommen in der Literatur vor allem im geschützten Anbau in Gewächs- und Folienhäusern beschrieben. Nach Untersuchungen der Nematologen Johannes Hallmann und Paul Dahlin vom Julius Kühn-Institut haben Eier und junge Larven im Freiland die kalten Winter 2008 bis 2010 am Standort Münster in Deutschland überlebt. Die Verbreitung erfolgt über infizierten Boden zum Beispiel mit Pflanzenmaterial, Jungpflanzen und bei der Bodenbearbeitung. Der Südliche Wurzelgallennematode hat einen großen Wirtspflanzenkreis und befällt die Wurzeln vieler verschiedener Pflanzen. Fast alle Arten der Kürbisgewächse Cucurbitaceae sind anfällig.
Pflanzenschutzmittel stehen zur Bekämpfung von Nematoden nicht zur Verfügung, sodass zur Reduzierung nur die Palette der Kulturmaßnahmen bleibt. Aufgrund des großen Wirtspflanzenkreises von Meloidogyne incognita können Anbaupausen mit wechselnden Kulturen nur sehr bedingt die Probleme minimieren. Durch die Beseitigung von Unkräutern werden potentielle Wirtspflanzen reduziert. Sofern praktikabel und möglich sollte zur Reduzierung des Infektionsmaterials beim Abräumen der Kulturen möglichst viel Wurzelmasse entfernt werden. Um die Nematoden zu bekämpfen, können resistente Zwischenfrüchte wie Ölrettich (Rhaphanus oleiferus, Sorte ‘Commodore‘) oder Feindpflanzen wie Sudangras (Sorghum sudanense) eingesetzt werden.
Häufig zur Bekämpfung anderer Nematoden eingesetzte Feindpflanzen wie Tagetes oder Hanf zeigen keine oder nur eine zweifelhafte Wirkung. Die Wirkung einer mehrmonatigen Schwarzbrache im Sommer, die die Nematodenanzahl nachhaltig senken kann, muss gegen eine durch die Brache verursachte mögliche Erosion und Veränderung der Bodenstruktur abgewogen werden.
Nematodenreduzierende Wirkungen können durch pH-Wert-Erhöhungen mittels Kalkdüngung oder durch den Einsatz verschiedener organischer Düngerformen wie Neem-Cake, Chitin, Lupinenschrot oder Hühnermist erreicht werden. Zurückzuführen ist dies auf unterschiedliche Effekte beim Abbau der organischen Materialien, unter anderem auf das C/N-Verhältnis, die mikrobielle Aktivität, die Bodentemperaturen und die Freisetzung nematodentoxischer Substanzen. Pilzliche und bakterielle Antagonisten zeigten in Versuchen ebenfalls Wirkungen hinsichtlich der Reduzierung der Nematodenanzahl. Abschließende oder praxistaugliche Anwendungen liegen hierzu noch nicht vor.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen