
Stärkung der Wertschöpfungsketten
Die Bio-Strategie der Bundesregierung hat zum Ziel, dass 30?% der landwirtschaftlichen Nutzfläche bis 2030 ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Hierfür müssen die Wertschöpfungsketten ausgebaut werden. Daran arbeiten aktuell einige Projekte.
von Redaktion erschienen am 28.01.2025Die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft ist im Fokus der Politik, wie die Bio-Strategie 2030 zeigt. Diese hat zum Ziel, eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft für Umwelt, Tiere und Klima zu gestalten, in der die Landwirte gleichzeitig ökonomisch tragfähig wirtschaften können. Die Zukunftskommission Landwirtschaft misst hierbei dem Ökolandbau eine wichtige Rolle für die Transformation der gesamten Landwirtschaft zu. Dementsprechend hat die Bundesregierung sich vorgenommen, dass bis zum Jahr 2030 30 % der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden sollen.
Angestrebt wird eine ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft, die zur nachhaltigen Entwicklung der gesamten Ernährungs- und Landwirtschaft beiträgt und auch konventionellen Unternehmen eine Entwicklungsperspektive aufzeigt. Dafür verfolgt die Bio-Strategie fünf zentrale Punkte: Gemeinwohlleistungen der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft besser honorieren, nachhaltiges Wirtschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette stärken, die Verarbeitung von Bio-Lebensmitteln unterstützen und ihren Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung steigern sowie Forschung, Wissenstransfer, Datenverfügbarkeit und Infrastruktur für die ökologische Lebensmittelkette stärken und Lösungen für bürokratische Herausforderungen erarbeiten.
Damit diese Ziele erreicht werden und die ökologische Landwirtschaft langfristig eine Zukunftsperspektive bleibt, braucht es tragfähige Konzepte. Schließlich bringt es nichts, mehr Bio-Lebensmittel zu produzieren, wenn diese nicht verkauft und verwertet werden. So gibt es immer mehr Ansätze, regionale Wertschöpfungsketten für Bio-Produkte zu etablieren – von der Betriebsmittelbereitstellung über die Erzeugung und Verarbeitung bis hin zum Handel und Konsum. Darin sieht die Bundesregierung die Chance, dass mehr Betriebe ihre Flächen auf die ökologische Bewirtschaftung umstellen können.
Im Jahr 2023 wirtschafteten in Deutschland 36.680 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus auf insgesamt 1,89 Millionen Hektar. Dies sind von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche rund 11,4 %, der Anteil der Ökobetriebe an allen Betrieben beträgt 14,4 % (BMEL 2024). Die Anzahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig (-232 Betriebe) – erstmals in den vergangenen 30 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Flächenwachstum bei 1,6 %.
Der durchschnittliche Ökobetrieb bewirtschaftet knapp 52 ha, wobei eine große Spannweite innerhalb der Betriebe besteht. Zur Gruppe der Ökobetriebe gehören Betriebe mit Spezialkulturen wie Wein auf wenigen Hektar Anbaufläche oder auch Betriebe mit Mutterkuhhaltung auf über 1.000 ha. Die Bedeutung des ökologischen Landbaus variiert regional beträchtlich. Der relative Flächenanteil reichte im Jahr 2023 von knapp 21 % im Saarland und 17 % in Brandenburg bis zu 6 % in Niedersachsen. In absoluten Zahlen betrachtet liegen die Schwerpunkte der ökologischen Wirtschaftsweise in Süddeutschland und im Nordosten: 2023 wurden in Bayern 420.037 ha und in Baden-Württemberg 208.085 ha ökologisch bewirtschaftet; in Brandenburg betrug die Ökolandbaufläche 225.245 ha und in Mecklenburg-Vorpommern 205.374 ha. Auf diese vier Bundesländer entfällt mehr als die Hälfte (56 %) der ökologisch bewirtschafteten Fläche Deutschlands (BMEL 2024).
von Thünen-InstitutAufbau einer Bio-Wertschöpfungskette
Einige Ansätze für eine regionale Wertschöpfungskette gibt es zum Beispiel in Karlsruhe. Dort läuft aktuell noch bis September das Projekt „KA.WERT“ („KArlsruher WERTschöpfungskette“). Es ist eines von 46 RIWERT-Projekten, die durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über das Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL) gefördert werden und Wertschöpfung in der Region generieren wollen, die allen Stufen der Lebensmittelkette zugutekommt. Hierbei geht es um den Aufbau und Intensivierung der Kooperation zwischen landwirtschaftlichen Bio-Betrieben und umstellungsinteressierten Betrieben, Verarbeitungsunternehmen, dem Einzelhandel sowie der Außer-Haus-Verpflegung im Kreis Karlsruhe. Kurz gesagt: es soll eine Bio-Wertschöpfungskette für Hülsenfrüchte, Gemüse und Kartoffeln geschaffen werden, indem das Projekt regionale Akteure unterstu¨tzt. Das erhöht nicht nur die Lebensmittelsouveränität und ermöglicht den Karlsruhern eine gesunde Ernährung, sondern trägt auch einen wichtigen Teil zur angestrebten Klimaneutralität bei. Immerhin hat sich sie Bio-Stadt Karlsruhe zusätzlich dazu verpflichtet, den Bio-Anteil in kommunalen Kantinen auf 30?% zu steigern. Deshalb spielt die Außer-Haus-Verpflegung auch eine bedeutende Rolle im Projekt. Lokale Cateringunternehmen sollen zum Großteil die Essensversorgung übernehmen, wobei der Transportweg und CO2-Fußabdruck berücksichtigt werden.
Bei „KA.WERT“ geht es nicht nur um einen regen Austausch zwischen den beteiligten Projektpartnern. Auch Informationsangebote, Weiter- und Fortbildungen zur Bio-Zertifizierung, zu Hülsenfrüchte, zu Nachhaltigkeitskriterien und zur Kooperationskompetenz-Stärkung werden bereitgestellt. Wissenschaftliche Einrichtungen begleiten die Umstellungsprozesse.
Erste BioRegio Karlsruhe: Vernetzen von Gastronomen und Erzeugern
Eine Veranstaltung, die aus dem Projekt „KA.WERT“ entstanden ist, war die BioRegio in Karlsruhe. Auf der Veranstaltung waren nicht nur zahlreiche Akteuren aus der Region zu finden, sondern es wurden in Vorträgen von Bio-Landwirten, Bio-Weingütern und Bio-Verarbeitern auch allerlei Ideen vorgestellt, wie eine regionale Bio-Wertschöpfung inklusive Außer-Haus-Verpflegung in Karlsruhe gelingen kann.
„Unser Netzwerk steht für eine gute und gesunde Ernährungskultur“, begrüßte Sandra Schmidt, Koordinatorin von „KA.WERT“, die Besucher der BioRegio-Initialveranstaltung. „Unser Ziel ist es, mehr regionale Bio-Lebensmittel nach Karlsruhe und auf unsere Teller zu bringen“, so Schmidt. Seit dem Projektstart im Jahr 2021 hat die Agrarbiologin bereits einige Aktivitäten und Kooperationen angestoßen: Im „KA.WERT“-Netzwerk haben sich 22 Bio-Landwirte, 12 Bio-Verarbeitungsbetriebe und 9 Handelsunternehmen zusammengeschlossen. Mit der Initialveranstaltung BioRegio sollte nun besonders der Bereich der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) adressiert werden.
Bewusstseinswandel entscheidend
Neben dem Förderprojekt setzen sich weitere Initiativen für eine nachhaltige und regionale Bio-Küche in Karlsruhe ein. Die Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen und Lebensmittelreste drastisch zu verringern, hat zum Beispiel die Initiative FoodCircle zum Ziel. Diese versteht sich als Nahversorgungszentrum mit regionalen und saisonalen Bio-Produkten für Karlsruhe und will die regionale Landwirtschaft mit dem Lebensmittelhandwerk und der Stadt-Bevölkerung zusammenbringen. „Wir können vieles organisieren und auf die Beine stellen, aber dafür brauchen wir zunächst einen Bewusstseinswandel“, betonte Hossein Fayazpour vom FoodCircle. Um dies zu erreichen, engagiert sich FoodCircle unter anderem an Schulen. In einem Schulprojekt sei es gelungen, die Abfallmenge an Lebensmittelresten von 30 auf vier Kilo pro Tag zu reduzieren. Maßgeblich dazu beigetragen habe ein externer Koch, der im intensiven Dialog mit den Schülern, deren Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln erhöht hat.
Kooperation von Erzeuger und Verarbeitung
Dank „KA.WERT“ haben sich der Bioland-Betrieb Petrik in Pfinztal und die Ludwig Schenk GmbH & Co. KG gefunden. Auf Bestellung bietet das seit 2019 bio-zertifizierte Karlsruher Obst- und Gemüsegroßhandelsunternehmen Kartoffeln, Gemüse und Salate geputzt, geschält und geschnitten an. Zustande gekommen ist die Kooperation zwischen dem Bio-Landwirt und dem Gemüsegroßhändler durch eine Anfrage der Kantine des badischen Energieversorgungsunternehmens EnBW. „Eingestiegen sind wir mit schnittfertigen Salatmischungen, inzwischen sind Karottenstifte und -würfel hinzugekommen“, so Florian Petrik. Damit sich für ihn die Anfahrt und Lieferung lohnt, hofft er auf wachsende Bestellmengen.

Ein Problem, das sich beim Austausch auf der BioRegio herauskristallisierte, ist der hohe Aufwand für Gastronomen, überhaupt Bio-Ware beziehen zu können. Besonders, so die Erfahrung von Frank Kemmerling vom Restaurant „fünf“, wenn der Warenbedarf kleinteilig ist. Sein Ziel ist es, das Speiseangebot mit Ökologie, Nachhaltigkeit und möglichst geringem Ressourcenverbrauch in Einklang zu bringen. Doch dabei stößt der Karlsruher Gastronom immer wieder an Grenzen. „Aufgrund unserer wöchentlich wechselnden Speisekarte benötigen wir meist viele verschiedene Dinge, und die nur in kleinen Mengen.“ Das gelte besonders für die in den Wintermonaten angebotene Menüreihe mit ausschließlich regionalen Lebensmittel. „Für die kleinen Bestellmengen finden wir so gut wie keine Lieferanten und müssen deshalb selber viel fahren, um die Ware abzuholen“, bedauert Frank Kemmerling.
Digitaler Marktplatz erleichtert Beschaffung
Abhilfe verspricht „nearbuy“, eine B2B-Plattform für die Vermarktung und Beschaffung regionaler Bio-Produkte. Das nearbuy-Team hat auf Wunsch der Gastronomie diese Plattform aufgebaut. Im engen Austausch mit Profiküchen haben sich Logistik und Bündelung als eine der wesentlichen Hürden für den Einsatz bio-regionaler Zutaten herauskristallisiert. „Viele Anbieter und Abnehmer kommen nicht zusammen, weil sie schlichtweg nicht sichtbar sind und nicht voneinander wissen“, sagte Doreen Havenstein von nearbuy. Genau hier setzt der digitale Marktplatz an: Er liefert einen Überblick über das aktuell verfügbare Angebot an bio-regionalen Produkten. Mit wenigen Klicks können die Nutzer gezielt nach dem suchen, was sie aktuell brauchen.
In der Bio-Musterregion Freiburg haben gut 65 erzeugende und verarbeitende Betriebe, 30 große und kleine Küchen in KiTa, Schule, Unternehmen und Gastronomie und acht bündelnde und liefernde Betriebe in einer einjährigen Pilotphase nearbuy getestet. Nach dem erfolgreichen Start in Südbaden möchten die Initiatorinnen von nearbuy die Plattform nun auf Mittelbaden und Karlsruhe ausdehnen und hoffen auf eine rege Mitwirkung.
BioRegio Symposium
Immer mehr Vernetzungsveranstaltungen für Praktiker, Wissenschaftler und Unternehmer der Bio-Branche werden ins Leben gerufen. Neben der BioRegio enstand so auch das BioRegio-Symposium bei Ravensburg, organisiert vom Projektteam „BioRegio Außer-Haus“ in Kooperation mit dem Demeter Landesverband Baden-Württemberg e.V.. Es ging vor allem um die Zukunft der regionalen Bio-Lebensmittelversorgung in Großküchen und Kantinen der Bodenseeregion. Genau hier setzt „BioRegio Außer-Haus“ an, ein 2-jähriges Projekt, das im Rahmen der Europäische Innovationspartnerschaft läuft. Projektleiterin Bettina Dreiseitl-Wanschura präsentierte das Vorhaben auch beim BioRegio-Symposium: Die Gründung eines Verarbeitungsbetriebs für Biogemüse, Cateringbetriebe, die auf Bio umstellen oder Neugründungen, der Aufbau von kommunalen Frischeküchen, die selbst bioregional kochen und ein Kooperationsnetzwerk, das mehr Verbindlichkeit und Wirtschaftlichkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette schafft – dies wären die großen Chancen für mehr BioRegio in den Kantinen und Mensen der Bodenseeregion.
BioRegio Außer-Haus
Die Bodenseeregion weist die die höchste Dichte an Öko-Betrieben weltweit auf und eignet sich somit bestens dafür, eine regionale Wertschöpfungskette für Bio-Ware aufzubauen. Deshalb setzt dort auch „BioRegio Außer-Haus“ an – wie der Name schon sagt, mit dem Fokus auf die Gemeinschaftsverpflegung in Kantinen und Mensen. Dies ist nicht nur gut fürs Klima und die Sicherung der Böden und damit unserer Nahrung, sondern versorgt auch die Menschen in betreuten Einrichtungen mit guten und gesunden Nahrungsmitteln und die regionalen Öko-Landwirte mit einem zusätzlichen Absatzmarkt.
Dies zahlt auch auf das Ziel der Bundesregierung ein, die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft auszubauen auf 30?% der in Deutschland landwirtschaftlich genutzten Fläche. Parallel dazu soll der regionale Bio-Warenanteil in der Außer-Haus Versorgung auf 30 bis 40?% steigen, ebenfalls bis 2030. Privathaushalte im Bodenseekreis konsumieren schon heute 30 bis 40?% Bio-Lebensmittel. Das Potenzial für Bio in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) liegt somit auf der Hand. Dafür braucht es die Zusammenarbeit von Erzeugern und der AHV. Denn wo mehr Bio produziert wird und verlässlich in der AHV verankert werden soll, braucht es auch neue Strukturen, Konzepte und die enge Zusammenarbeit all jener, die an der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Deshalb durchleuchtet „BioRegio Außer-Haus“ Chancen und Herausforderungen, kreiert neue Mechanismen und spielt diese in Modellprojekten durch. Das heißt, wissenschaftliche Institutionen entwickeln gemeinsam mit der gesamten Wertschöpfungskette – von der Gemüseproduktion bis hin zum Verzehr – erste Konzepte, die den regionalen Bio-Anteil in den Projekt-Kantinen auf die geforderten 30 bis 40?% steigern und die Lebensmittelverschwendung auf ein Minimum reduzieren sollen. Große Herausforderungen und gleichzeitig große Potenziale liegen in der innovativen Vorfertigung von Gemüse, der Beratung von Kantinen sowie in der Digitalisierung und Logistik. Das beinhaltet auch Preiskonkurrenz, Kostenneutralität oder Menüpläne, genauso wie die Beratung und Motivation des Küchenpersonals hinsichtlich neuer Verfahren und ihrer Chancen. Letztlich entsteht so eine Brücke zwischen Bio-Produzenten und Kantinen-Konsument.

Vom Projekt in die Praxis
Ein bereits funktionierendes Konzept stellte Monika Forster von der Energieagentur Vorarlberg mit dem Projekt „Schullokal“ beim BioRegio-Symposium vor. Das sind drei Frischeküchen, welche die Volks- und Mittelschulen in neun Gemeinden des Vorderen Bregenzer Waldes mit frischem, nachhaltigem Essen beliefern. Diese Schullokale sind mittlerweile so erfolgreich, dass die Kids auf andere Angebote wie Imbissbuden verzichten. „So können wir auch eine positive Prägung der Essgewohnheiten für gesunde, regionale und saisonale Menüs bei den Schülern bewirken“, zeigt Forster auf. Herausfordernd sei allerdings der Aufbau einer regionalen Logistik als Grundlage für ein reibungsloses Funktionieren.
Ein weiteres Praxisbeispiel sind die Tressbrüder mit ihrer Art „HelloFresh“-Konzept für die AHV, indem sie vorgefertigte Rohstoffe an die AHV liefern, die dann von den Einrichtungen zubereitet werden. Damit übernimmt das Unternehmen eine Bündelungs-, Handels- und Logistikfunktion und kann auch preislich konkurrieren. „Denn der Direktbezug von Waren bei Landwirten ist für beide Parteien vorteilig und sorgt für faire Preise, insbesondere der Bezug in größeren Gebinden“, sagt Christian Tress.
Fakt ist also: Es sind sich nahezu alle einig, dass eine regionale und ökologische Versorgung mit Lebensmitteln die Zukunft ist. Hierfür müssen die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette Hand in Hand arbeiten. Einige Beispiele zeigen, dass dies wirklich funktionieren kann und die laufenden Projekte arbeiten auf Hochtouren daran, für entstehende Probleme Lösungen zu finden – damit die Verpflegung mit ökologischen und regionalen Lebensmitteln bis 2030 und auch darüber hinaus gelingen kann.









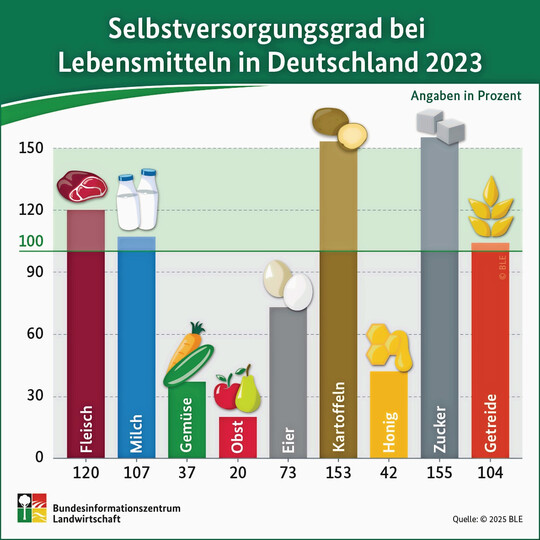









Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.