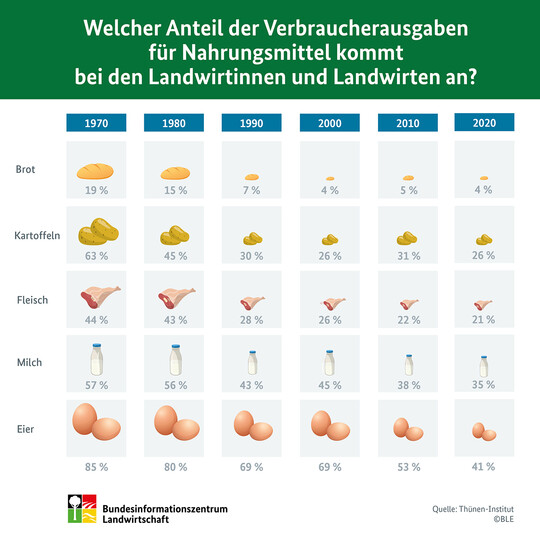Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln muss praxisnahe sein
Ende September 2012 hat das Bundeslandwirtschaftsministerium den Entwurf des Nationalen Aktionsplanes zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) vorgelegt.
- Veröffentlicht am
Die Fachgruppe Gemüsebau hatte Gelegenheit, über den Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG) und den Zentralverband Gartenbau (ZVG) Stellung zu beziehen. Gerhard Schulz, Vorsitzender der Fachgruppe Gemüsebau betonte, dass grundsätzlich das Ziel des NAP die Risiken, die mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbunden sein können, weiter zu mindern, zu unterstützen sind.
Besonders im Gemüsebau wird schon seit über zwei Jahrzehnten nach den Richtlinien des kontrollierten Integrierten Anbaus als umweltschonendes Anbauverfahren gearbeitet. Nach Schätzungen der Fachgruppe Gemüsebau wird auf circa 90 % der Gemüseanbaufläche in Deutschland mittlerweile nach diesen umweltschonenden – vom Berufsstand selbst auferlegten Anbau- und Umweltstandards gearbeitet, mit wachsender Tendenz. Besonders der Part des integrierten Pflanzenschutzes bildet einen zentralen wichtigen Bestandteil dieser Vorgaben, stellte Schulz heraus.
Nachhaltiger Pflanzenschutz beinhalte aber auch, dass die Pflanzenschutzstrategien unter Beachtung der wirtschaftlichen und sozioökonomischen Aspekte ausgewählt werden. Diese Aspekte seien im NAP noch weiter zu vertiefen, damit alle Bereiche der Nachhaltigkeit angemessen berücksichtigt werden. Zudem müsse der Nutzen des Pflanzenschutzes klarer herausgestellt werden.
Der Berufsstand sieht jedoch auch, dass es an Anreizen fehlt, um den NAP und seine Umsetzung in allen seinen Teilen flächendeckend in allen Agrarbereichen zu erreichen.
Dies wird besonders an der Entwicklung der Offizialberatung in den Ländern deutlich. Die Umsetzung des Aktionsplanes kann nur gelingen, wenn die hochkomplexen Zusammenhänge im Pflanzenschutz als Bestandteil des Wissens erfahrener Berater unterstützend und immer wieder aktuell in die Praxis getragen werden. Dementsprechend bedarf es einer Sicherung und Ausweitung der Beratung. Zurzeit ist es aber eher Realität in den Ländern, dass Beratungskapazitäten abgebaut oder nur noch mit Kontrollaufgaben beschäftigt werden. Hier sind Bund und Länder gefordert, die Beratung in diesem sensiblen Bereich zu stärken und langfristig zu sichern, sagte Schulz. Der NAP sieht vor, dass für jedes Anwendungsgebiet mindesten drei Wirkstoffe zur Resistenzvermeidung zur Verfügung stehen sollten. Das wird von der Fachgruppe Gemüsebau positiv angemerkt. Die Realität zeigt jedoch, dass wir heute zu oft nicht mal einen Wirkstoff, der dazu eine selektive Wirkung und nützlingsschonend sein soll, zur Verfügung haben. Hier liegen die Herausforderungen‘ der kommenden Jahre für den deutschen und europäischen Gemüsebau, unterstrich Schulz. Ebenso sei es wichtig, sich im NAP auf diejenigen Bereiche zu beschränken, die einen direkten Bezug zum Pflanzenschutz aufweisen. Dies sei beispielsweise mit dem Bereich Biodiversität nicht eindeutig gegeben. Hier sei die Datenlage dürftig. Die Fachgruppe Gemüsebau wird sich auch weiterhin aktiv für die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplanes einsetzen, die das Hauptziel haben, die Risiken in der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln weiter zu minimieren. Schulz forderte dazu auch weiterhin die Unterstützung durch Forschung, Wirtschaftspartner und auch der staatlichen Stellen ein. Er sieht in den vorgesehenen kultur- und sektorbezogenen Leitlinien zum Integrierten Pflanzenschutz eine mögliche gute Hilfestellung für die Gemüsepraxis.
Besonders im Gemüsebau wird schon seit über zwei Jahrzehnten nach den Richtlinien des kontrollierten Integrierten Anbaus als umweltschonendes Anbauverfahren gearbeitet. Nach Schätzungen der Fachgruppe Gemüsebau wird auf circa 90 % der Gemüseanbaufläche in Deutschland mittlerweile nach diesen umweltschonenden – vom Berufsstand selbst auferlegten Anbau- und Umweltstandards gearbeitet, mit wachsender Tendenz. Besonders der Part des integrierten Pflanzenschutzes bildet einen zentralen wichtigen Bestandteil dieser Vorgaben, stellte Schulz heraus.
Nachhaltiger Pflanzenschutz beinhalte aber auch, dass die Pflanzenschutzstrategien unter Beachtung der wirtschaftlichen und sozioökonomischen Aspekte ausgewählt werden. Diese Aspekte seien im NAP noch weiter zu vertiefen, damit alle Bereiche der Nachhaltigkeit angemessen berücksichtigt werden. Zudem müsse der Nutzen des Pflanzenschutzes klarer herausgestellt werden.
Der Berufsstand sieht jedoch auch, dass es an Anreizen fehlt, um den NAP und seine Umsetzung in allen seinen Teilen flächendeckend in allen Agrarbereichen zu erreichen.
Dies wird besonders an der Entwicklung der Offizialberatung in den Ländern deutlich. Die Umsetzung des Aktionsplanes kann nur gelingen, wenn die hochkomplexen Zusammenhänge im Pflanzenschutz als Bestandteil des Wissens erfahrener Berater unterstützend und immer wieder aktuell in die Praxis getragen werden. Dementsprechend bedarf es einer Sicherung und Ausweitung der Beratung. Zurzeit ist es aber eher Realität in den Ländern, dass Beratungskapazitäten abgebaut oder nur noch mit Kontrollaufgaben beschäftigt werden. Hier sind Bund und Länder gefordert, die Beratung in diesem sensiblen Bereich zu stärken und langfristig zu sichern, sagte Schulz. Der NAP sieht vor, dass für jedes Anwendungsgebiet mindesten drei Wirkstoffe zur Resistenzvermeidung zur Verfügung stehen sollten. Das wird von der Fachgruppe Gemüsebau positiv angemerkt. Die Realität zeigt jedoch, dass wir heute zu oft nicht mal einen Wirkstoff, der dazu eine selektive Wirkung und nützlingsschonend sein soll, zur Verfügung haben. Hier liegen die Herausforderungen‘ der kommenden Jahre für den deutschen und europäischen Gemüsebau, unterstrich Schulz. Ebenso sei es wichtig, sich im NAP auf diejenigen Bereiche zu beschränken, die einen direkten Bezug zum Pflanzenschutz aufweisen. Dies sei beispielsweise mit dem Bereich Biodiversität nicht eindeutig gegeben. Hier sei die Datenlage dürftig. Die Fachgruppe Gemüsebau wird sich auch weiterhin aktiv für die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplanes einsetzen, die das Hauptziel haben, die Risiken in der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln weiter zu minimieren. Schulz forderte dazu auch weiterhin die Unterstützung durch Forschung, Wirtschaftspartner und auch der staatlichen Stellen ein. Er sieht in den vorgesehenen kultur- und sektorbezogenen Leitlinien zum Integrierten Pflanzenschutz eine mögliche gute Hilfestellung für die Gemüsepraxis.
Mehr zum Thema:
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen