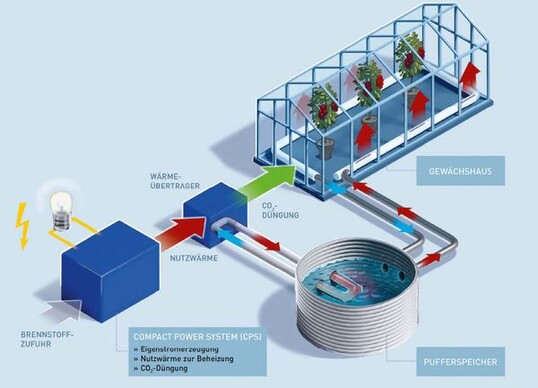Interview mit Tobias Vetter
Agri-PV versus Freiflächen-PV
Tobias Vetter hat im Rahmen seiner Masterarbeit an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf das Potenzial von Agri-PV-Anlagen mit klassischen Freiflächen-Photovoltaikanlagen verglichen.
- Veröffentlicht am

Herr Vetter, um was ging es bei Ihrer Arbeit? Im Rahmen des Forschungsprojekts „HyPErFarm“, das im „Horizon 2020 Research and Innovation Programme“ der Europäischen Union gefördert wurde, lag mein Forschungsschwerpunkt auf der Erstellung eines Life Cycle Assessment (LCA) von Agri-Photovoltaikanlagen (Agri-PV-Anlagen) sowie der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit. In diesem internationalen Projekt, das vier Länder und 13 Partner umfasst, sind neben Universitäten auch Unternehmen, Forschungseinrichtungen und landwirtschaftliche Betriebe beteiligt. Als deutsche Projektteilnehmer sind hier die Firma Krinner GmbH, das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, an der ich tätig war, zu...