Kooperieren statt verbieten
Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) spricht sich anlässlich des vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegten Entwurfs zur Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung deutlich gegen Pflanzenschutzverbote aus, will aber weiterhin kooperativ am Insektenschutzprogramm mitarbeiten. Auch der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) hält einzelne der geplanten Regelungen im Rahmen des Insektenschutzpakets der Bundesregierung für nicht zielführend, wirkungslos und in Teilen sogar kontraproduktiv. Dies machte er in seiner Stellungnahme an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) deutlich.
- Veröffentlicht am

„Verbote hebeln wichtige und wegweisende Länderaktivitäten aus, wie beispielsweise in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg“, kommentiert ZVG-Präsident Jürgen Mertz den vorgelegten Entwurf. Notwendig seien regionale und standortangepasste Regelungen.
Gerade für den Anbau von Obst und Gemüse bedarf es der Möglichkeit, boden- und kulturschonend Unkrautbekämpfungs- und gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen zu können. Der ZVG lehnt die Ausweitung von Verboten insbesondere in FFH-Gebieten daher entschieden ab.
Der ZVG betont die Notwendigkeit, vorrangig den Integrierten Pflanzenschutz weiter zu entwickeln. Dazu bedarf es eines begleitenden umfassenden Förderprogramms sowie Unterstützung der Praxis.
Hintergrund
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat den Entwurf zur Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung in die Verbändeanhörung gegeben. Kommende Woche soll das Bundeskabinett über die Änderungen auch im Zusammenhang mit dem Insektenschutzgesetz beschließen.
Grundlage ist das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung. Mit der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung sollen sowohl Maßnahmen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus dem Aktionsprogramm Insektenschutz als auch die Glyphosat-Minderungsstrategie umgesetzt werden.
Gemeinsame Erklärung
Zahlreiche Verbände aus dem Agrarsektor betonen in einer gemeinsamen Erklärung, wie wichtige Kooperationen statt pauschale Verbote beim Insekten- und damit Artenschutz sind. Eine Neuausrichtung des Aktionsprogramms Insektenschutz sei daher wichtig. Die unterzeichnenden Verbände fordern deshalb die Bundesregierung auf, den Entwurf für das Insektenschutz-Paket zurückziehen mit dem Ziel, gemeinsam einen kooperativen und tragfähigen Vorschlag für mehr Biodiversitätsleistungen der Landwirte und Landnutzer zu entwickeln.
Ein erster kooperativer Ansatz der unterzeichnenden Verbände sieht folgende Punkte vor:
- Vorrang für Kooperation und Freiwilligkeit vor Verboten und Auflagen im Natur- und Artenschutz. Verlässliche Finanzierung der vereinbarten Maßnahmen.
- Vorrang für kooperative Länderkonsense nach den Vorbildern Niedersachsen, Baden-Württemberg und anderer Länder.
- Sicherstellung der vollen Förderfähigkeit der Flächen (EU-Agrarförderung, Agrarumweltmaßnahmen, Ökolandbauprämie, Wasserkooperationen, Vertragsnaturschutz etc.)
- Vertrauensschutz und Einhaltung der Zusage, dass in FFH- und Vogelschutzgebieten Bestandsschutz für die Bewirtschaftung besteht und zusätzliche Umweltleistungen über Vertragsnaturschutz umgesetzt werden.
Die komplette Erklärung können Sie hier herunterladen.
Anwendungsverbote rechtlich fragwürdig und in Teilen kontraproduktiv
Auch der IVA mahnt in einer Stellungnahme Korrekturen am Insektenschutzpaket an. Der weltweite Rückgang der Insektenpopulationen ist nach Ansicht des IVA ein ernst zu nehmendes Phänomen und wissenschaftlich hinreichend belegt. Umso wichtiger sei es, jetzt wirklich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, statt sich in einer Symbolpolitik zu üben, bei der der Landwirtschaft einseitig die Rolle des Sündenbocks zugewiesen wird.
So lehnt der IVA ein pauschales Anwendungsverbot von Pflanzenschutzmitteln in Gebieten mit Bedeutung für den Naturschutz ab. „Von außen betrachtet, mag mancher sich fragen, was Pflanzenschutzmittel in diesen Gebieten zu suchen haben. Aber: Es ist nicht selten, dass landwirtschaftliche Betriebe mit ihrer gesamten Anbaufläche in Schutzgebieten liegen. Auch diese Landwirte müssen ihre Kulturen vor Pilzen und Schädlingen schützen“, erläutert IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer.
Nach Ansicht des IVA würde ein solches Verbot sogar kontraproduktiv wirken: Schutzgebiete profitieren stark von ihrer heterogenen Landschaftsstruktur, etwa durch Obst- oder Weinbau. Wenn dort landwirtschaftliche Produktion durch ein pauschales Verbot von Pflanzenschutzmitteln unmöglich wird, könnte die Landschaft strukturell verarmen. „Schutzgebiete sind oft Kulturlandschaften. Manche Arten haben sich erst in Folge der agrarischen Nutzung hier angesiedelt. Verschwindet hier die Landwirtschaft, verarmt auch die Artenvielfalt. Das wäre ein Bärendienst für die Biodiversität“, so Gemmer.
Globale Folgen
Nach Branchenschätzung gingen der Landwirtschaft durch die Maßnahmen in Summe 7 Prozent ihrer Anbaufläche verloren. Betroffen sind vor allem Obst und Gemüse. „Schon heute können wir unseren Bedarf an diesen Nahrungsmitteln nicht selbst decken. Die Importabhängigkeit würde weiter steigen. Und natürlich hat es Folgen auch für die globale Biodiversität, wenn für unseren Bedarf in anderen Weltregionen natürliche Flächen in Agrarland umgewandelt werden“, so Gemmer. Er fordert daher: „Wir brauchen dringend eine umfassende Gesetzesfolgenabschätzung! Ohne diese robuste Basis bleiben die geplanten gesetzlichen Maßnahmen willkürlich.“
Für rechtlich fragwürdig hält der IVA die im Änderungsentwurf zur Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung angeführte Begründung für die Einschränkung der Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmitteln. Der monokausale Einfluss („negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt“) eines einzelnen Wirkstoffs, der Glyphosat hier zugewiesen wird, ist wissenschaftlich nicht belegt. Der IVA erinnert daran, dass der Wirkstoff nach intensiver Überprüfung – mit Beteiligung deutscher Bewertungsbehörden – auf europäischer Ebene genehmigt wurde und aktuell ein Dossier zu Erneuerung der Wirkstoffgenehmigung in Brüssel eingereicht wurde. „Wir haben seit über zehn Jahren aus gutem Grund ein europäisches Pflanzenschutzrecht. Das dürfen wir nicht ständig durch nationale Sonderwege untergraben“, betonte Gemmer.


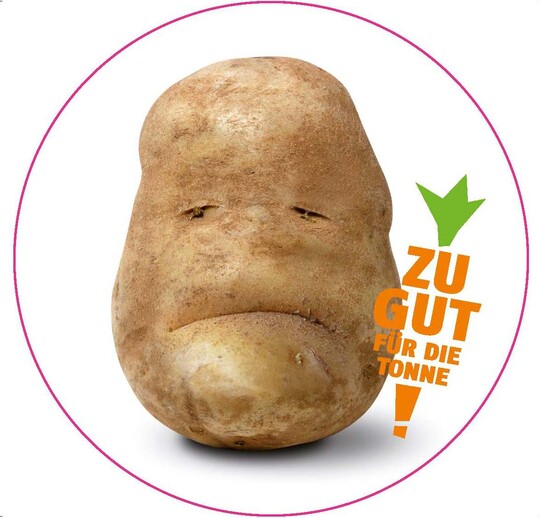





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.