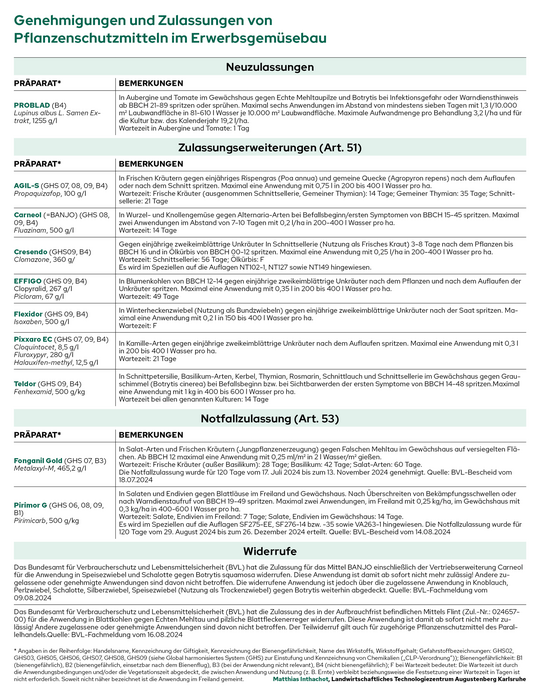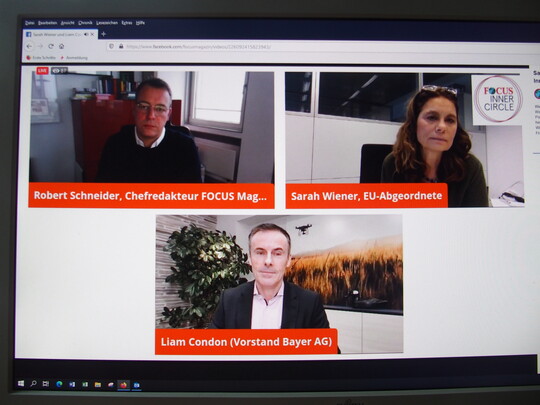Studie - Gemüse ist nicht nur ein Nahrungsmittel
Nationale Verzehrsstudie II zeigt: Armutsrisikogruppen verzehren weniger Gemüse
Fast jede sechste Person war nach den Ergebnissen der Erhebung „Leben in Europa“ (EU-SILC) 2013 in Deutschland armutsgefährdet – das entsprach 16% der Bevölkerung oder rund 13 Mio. Menschen.
- Veröffentlicht am

Das ist umso erschreckender, da Armut in Deutschland einhergeht mit tief greifenden Gesundheitsproblemen. Die Bandbreite reicht von psychischen Erkrankungen und psychosomatischen Beschwerden bis hin zu chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Problemen. Drastischerweise führt das zu einer geringeren Lebenserwartung.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Aber eine Ursache ist der ungesunde Ernährungsstil der von Armut betroffenen Frauen und Männer, wie eine Auswertung der Nationalen Verzehrsstudie II von Faith Simpson und Petra Lührmann, Institut für Gesundheitswissenschaften der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, belegt. Die Nationale Verzehrsstudie II ist die derzeit aktuellste und umfassendste Datenerhebung zu Lebensmittelverzehr und Ernährungsverhalten in Deutschland. Die von Armut gefährdeten Frauen und Männer verzehrten weniger Obst, Fisch und Wasser, trinken aber deutlich mehr Limonaden als nicht von Armut betroffene Bevölkerungsgruppen. Armutsgefährdete Frauen essen zudem deutlich weniger Gemüse. Bei armutsgefährdeten Männern zeigt sich dies tendenziell. Daraus resultiert, dass die Verzehrsempfehlungen von 400 g Gemüse pro Tag bei den Armutsrisikogruppen nur von 30% der armutsgefährdeten Frauen und bei armutsgefährdeten Männern sogar nur von 26% erreicht werden.
Die Untersuchungen von Faith Simpson und Petra Lührmann machen aber auch deutlich, dass das Ernährungswissen einen stärkeren Einfluss auf das Ernährungsverhalten hat als das Armutsrisiko. Hier müssen wir ansetzen, hier sind Wissenschaft, Politik und Verbände gleichermaßen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit gefordert.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Aber eine Ursache ist der ungesunde Ernährungsstil der von Armut betroffenen Frauen und Männer, wie eine Auswertung der Nationalen Verzehrsstudie II von Faith Simpson und Petra Lührmann, Institut für Gesundheitswissenschaften der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, belegt. Die Nationale Verzehrsstudie II ist die derzeit aktuellste und umfassendste Datenerhebung zu Lebensmittelverzehr und Ernährungsverhalten in Deutschland. Die von Armut gefährdeten Frauen und Männer verzehrten weniger Obst, Fisch und Wasser, trinken aber deutlich mehr Limonaden als nicht von Armut betroffene Bevölkerungsgruppen. Armutsgefährdete Frauen essen zudem deutlich weniger Gemüse. Bei armutsgefährdeten Männern zeigt sich dies tendenziell. Daraus resultiert, dass die Verzehrsempfehlungen von 400 g Gemüse pro Tag bei den Armutsrisikogruppen nur von 30% der armutsgefährdeten Frauen und bei armutsgefährdeten Männern sogar nur von 26% erreicht werden.
Die Untersuchungen von Faith Simpson und Petra Lührmann machen aber auch deutlich, dass das Ernährungswissen einen stärkeren Einfluss auf das Ernährungsverhalten hat als das Armutsrisiko. Hier müssen wir ansetzen, hier sind Wissenschaft, Politik und Verbände gleichermaßen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit gefordert.
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen