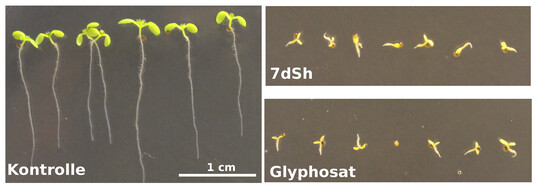Vermarktung
Das EU-USA-Freihandelsabkommen hat Auswirkungen auf die Gemüsebranche
Das geplante transatlantische EU-USA-Freihandelsabkommen (Englisch: Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP) deckt zahlreiche Bereiche der Wirtschaft, darunter auch die Landwirtschaft ab.
- Veröffentlicht am
Ziel ist es, die größte Freihandelszone der Welt mit rund 800 Mio. Menschen zu schaffen. Von einer Freihandelszone zwischen den beiden Seiten des Atlantiks verspricht man sich die Erleichterungen für den Zugang zu den Märkten des Partners durch Reduzierung tarifärer und nichttarifärer Handelshemmnisse.
Transatlantische Handelshemmnisse abbauen
Beide Partner sind im globalen Agrarhandel sehr dominant. Die Europäische Union (EU) exportiert überwiegend veredelte Produkte. Die USA exportieren nach Europa dagegen Rohstoffe mit geringerer Wertschöpfung. Die Befürworter des angestrebten Abkommens erwarten beiderseits positive Auswirkungen. In erster Linie soll die Abschaffung von Zöllen die Kosten transatlantischer Geschäftsbeziehungen senken. Denn momentan weichen die Vorschriften (sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse) in den beiden Wirtschaftsnationen voneinander ab. Um diese einzuhalten und in beiden Märkten aktiv zu sein, müssen viele Unternehmen zusätzliche Kosten tragen, weil sie beispielsweise zwei getrennte Herstellungsprozesse betreiben müssen.
Außerdem müssen die Unternehmen ihre Waren zusätzlich verzollen und die doppelt so hohen Kosten der Zulassungen tragen. Der Abbau der transatlantischen Handelshemmnisse trägt dazu bei, diese Kosten zu reduzieren und den wirtschaftlichen Nutzen für die Unternehmen zu erhöhen. Die Vereinfachung des Handels und die Angleichung der internationalen Standards eröffnet für viele Unternehmen neue Marktchancen. Würden mehr Unternehmen ihre Produkte auf dem neuen Markt anbieten, erweiterte sich die Produktauswahl und reduzierten die Preise für den Endverbraucher. Dies würde den Handel beleben, die Volkswirtschat stimulieren und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Laut einer Studie des Zentrums für Wirtschaftspolitikforschung (CEPR) in London würde ein Zusatzeinkommen für die Wirtschaft entstehen, das auf 119 Mrd. € pro Jahr für die EU und auf 95 Mrd. € pro Jahr für die USA geschätzt wird. Mehr Wirtschaftswachstum würde sich in Folge der höheren Nachfrage nach Rohstoffen zudem positiv auf den Arbeitsmarkt und den Außenhandel mit anderen Ländern auswirken, sodass die Weltwirtschaft als Ganzes davon profitieren könnte. Jedoch bestehen einige Interessenskonflikte zwischen Handelsunternehmen, Verbrauchern und Landwirten in beiden Wirtschaftsräumen. In der EU gelten sehr hohe Standards, sowohl in der Lebensmittelsicherheit als auch in den Bereichen Umweltund Verbraucherschutz, die sich von den Auflagen in den USA unterscheiden.
Anpassung auf Kosten von EU-Standards befürchtet
In der EU wird der Akzent nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit, sondern auch auf Produktqualität und Transparenz gelegt, um eine möglichst lückenl.se Rückverfolgung der Lieferkette zu gewährleisten. Die Kritiker des geplanten Abkommens fürchten, dass die europäischen Standards zugunsten der US-amerikanischen Großindustrie angepasst werden. Dies betrifft zum Beispiel im Bereich Gemüsebau der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. Gentechnisch veränderte Pflanzen müssen in den USA weder zugelassen noch gekennzeichnet werden.
In der EU besteht dagegen eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte, auch dann, wenn die Veränderung im Endprodukt nicht mehr nachweisbar ist. Allerdings sind von dieser Pflicht Zusatzstoffe, die von genetisch veränderten Bakterien erzeugt wurden, ausgenommen. Die Verbraucher wissen oft nicht, ob sie im Supermarkt Lebensmittel kaufen, die solche Zusatzstoffe enthalten. Falls die EU sich bei den Verhandlungen durchsetzen wird, müssten die US-amerikanischen Unternehmen, die auf dem EU-Markt aktiv sein wollen, solche Kontrollsysteme zunächst aufbauen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein wird. Allerdings sind die europäischen Verbraucher verunsichert, da sie nicht wissen, ob diese EUStandards bei den Verhandlungen aufgeweicht werden, und somit die aus der Sicht der Europäer umstrittene und gesundheitsbedenkliche Lebensmittel aus den USA in Europa verkauft werden. Zu den weiteren negativen Auswirkungen des Freihandelsabkommens gehören außerdem laut der Europäischen Kommission der zusätzliche Anstieg des weltweiten CO2-Ausstoßes, mehr Abfall, eine geringere biologische Vielfalt sowie die verstärkte Nutzung natürlicher Ressourcen.
Die möglichen Auswirkungen des EU-Freihandelsabkommens mit den USA stehen bereits seit vielen Jahren im Mittelpunkt der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen. Die Befürworter des Abkommens erhoffen sich mehr Wachstum für die Volkswirtschaft. Die Kritiker des Abkommens befürchten negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher und die Umwelt. Damit beide Wirtschaftsräume vom Abkommen profitieren können, müssen beide Partner zu weiteren gegenseitige Zugeständnisse bereit sein. Die Verhandlungen über das Abkommen werden voraussichtlich bis Ende 2015 dauern.
Transatlantische Handelshemmnisse abbauen
Beide Partner sind im globalen Agrarhandel sehr dominant. Die Europäische Union (EU) exportiert überwiegend veredelte Produkte. Die USA exportieren nach Europa dagegen Rohstoffe mit geringerer Wertschöpfung. Die Befürworter des angestrebten Abkommens erwarten beiderseits positive Auswirkungen. In erster Linie soll die Abschaffung von Zöllen die Kosten transatlantischer Geschäftsbeziehungen senken. Denn momentan weichen die Vorschriften (sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse) in den beiden Wirtschaftsnationen voneinander ab. Um diese einzuhalten und in beiden Märkten aktiv zu sein, müssen viele Unternehmen zusätzliche Kosten tragen, weil sie beispielsweise zwei getrennte Herstellungsprozesse betreiben müssen.
Außerdem müssen die Unternehmen ihre Waren zusätzlich verzollen und die doppelt so hohen Kosten der Zulassungen tragen. Der Abbau der transatlantischen Handelshemmnisse trägt dazu bei, diese Kosten zu reduzieren und den wirtschaftlichen Nutzen für die Unternehmen zu erhöhen. Die Vereinfachung des Handels und die Angleichung der internationalen Standards eröffnet für viele Unternehmen neue Marktchancen. Würden mehr Unternehmen ihre Produkte auf dem neuen Markt anbieten, erweiterte sich die Produktauswahl und reduzierten die Preise für den Endverbraucher. Dies würde den Handel beleben, die Volkswirtschat stimulieren und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Laut einer Studie des Zentrums für Wirtschaftspolitikforschung (CEPR) in London würde ein Zusatzeinkommen für die Wirtschaft entstehen, das auf 119 Mrd. € pro Jahr für die EU und auf 95 Mrd. € pro Jahr für die USA geschätzt wird. Mehr Wirtschaftswachstum würde sich in Folge der höheren Nachfrage nach Rohstoffen zudem positiv auf den Arbeitsmarkt und den Außenhandel mit anderen Ländern auswirken, sodass die Weltwirtschaft als Ganzes davon profitieren könnte. Jedoch bestehen einige Interessenskonflikte zwischen Handelsunternehmen, Verbrauchern und Landwirten in beiden Wirtschaftsräumen. In der EU gelten sehr hohe Standards, sowohl in der Lebensmittelsicherheit als auch in den Bereichen Umweltund Verbraucherschutz, die sich von den Auflagen in den USA unterscheiden.
Anpassung auf Kosten von EU-Standards befürchtet
In der EU wird der Akzent nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit, sondern auch auf Produktqualität und Transparenz gelegt, um eine möglichst lückenl.se Rückverfolgung der Lieferkette zu gewährleisten. Die Kritiker des geplanten Abkommens fürchten, dass die europäischen Standards zugunsten der US-amerikanischen Großindustrie angepasst werden. Dies betrifft zum Beispiel im Bereich Gemüsebau der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. Gentechnisch veränderte Pflanzen müssen in den USA weder zugelassen noch gekennzeichnet werden.
In der EU besteht dagegen eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte, auch dann, wenn die Veränderung im Endprodukt nicht mehr nachweisbar ist. Allerdings sind von dieser Pflicht Zusatzstoffe, die von genetisch veränderten Bakterien erzeugt wurden, ausgenommen. Die Verbraucher wissen oft nicht, ob sie im Supermarkt Lebensmittel kaufen, die solche Zusatzstoffe enthalten. Falls die EU sich bei den Verhandlungen durchsetzen wird, müssten die US-amerikanischen Unternehmen, die auf dem EU-Markt aktiv sein wollen, solche Kontrollsysteme zunächst aufbauen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein wird. Allerdings sind die europäischen Verbraucher verunsichert, da sie nicht wissen, ob diese EUStandards bei den Verhandlungen aufgeweicht werden, und somit die aus der Sicht der Europäer umstrittene und gesundheitsbedenkliche Lebensmittel aus den USA in Europa verkauft werden. Zu den weiteren negativen Auswirkungen des Freihandelsabkommens gehören außerdem laut der Europäischen Kommission der zusätzliche Anstieg des weltweiten CO2-Ausstoßes, mehr Abfall, eine geringere biologische Vielfalt sowie die verstärkte Nutzung natürlicher Ressourcen.
Die möglichen Auswirkungen des EU-Freihandelsabkommens mit den USA stehen bereits seit vielen Jahren im Mittelpunkt der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen. Die Befürworter des Abkommens erhoffen sich mehr Wachstum für die Volkswirtschaft. Die Kritiker des Abkommens befürchten negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher und die Umwelt. Damit beide Wirtschaftsräume vom Abkommen profitieren können, müssen beide Partner zu weiteren gegenseitige Zugeständnisse bereit sein. Die Verhandlungen über das Abkommen werden voraussichtlich bis Ende 2015 dauern.
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen