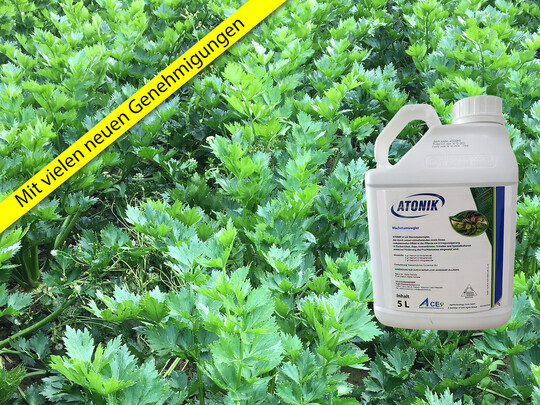Internationaler Gemüsebaukongress auf Hawaii
Gipfeltreffen der Gartenbauwissenschaftler
Rund 600 Wissenschaftler und Vertreter großer Unternehmen aus aller Welt, die meisten aus den USA, tauschten auf dem Internationalen Gemüsebaukongress die neuesten Erkenntnisse aus. Eingeladen hatte die amerikanische Gesellschaft für Gartenbauwissenschaften nach Waikoloa an der Westküste der „Großen Insel“ von Hawaii.
- Veröffentlicht am

Wirtschaft und Wissenschaft
Nick Dokoozlian, E&J Gallo, sagte, dass der Druck aus den Schwellenländern auf Europa und die USA immer stärker werde. Dem könne man nur mit Qualität entgegenhalten – und diese erfordere eine enge Kooperation mit der Wissenschaft.
Veredlung bringt Qualität
Die am meisten in Vorträgen behandelte Gemüseart war die Tomate.
Charles Barrett, Universität Florida, stellte fest, dass Veredeln sich auch auf die Qualität nicht negativ auswirkt: Bei Säure, Vitamin C- und Lycopingehalt zeigten sich keine Unterschiede im Vergleich zu nicht veredelten Tomaten. Hinsichtlich Vitamin B wurden nur bei einigen Sorten minimale Beeinträchtigungen nachgewiesen. Damit scheint bestätigt, dass die ertragssteigernde Wirkung der Veredlung keine negativen Konsequenzen auf die wertvollsten Inhaltsstoffe der Tomate hat.
Paprika leicht schattieren
Juan Carlos Díaz-Pérez, University Georgia, präsentierte Ergebnisse eines Versuchs über die Auswirkung der Schattierung auf die Photosynthese-Leistung von Paprika. Die Annahme im Vorfeld war dabei, dass dadurch die Qualität der Früchte gesteigert und der Wasserbedarf gleichzeitig gesenkt werden könne. Das hatten vorige Experimente bereits gezeigt. Unsicher war allerdings die Konsequenz bei der Photosynthese-Leistung, die den Ertrag bestimmt. Das Resultat war, dass eine Schattierung von 30 % weniger Lichtintensität den Ertrag nicht beeinträchtigt, jedoch Blatttemperatur und -wachstum senkt, was sich wiederum positiv auf Qualität, Wasser- und Nährstoffbedarf auswirkt.
Einlegegurken nicht zu dicht
Effizienzsteigerung war ein weiterer Fokus, den viele Referenten in den Mittelpunkt stellten.
Jonathan R. Schultheis, Universität von North Carolina State, empfiehlt als optimale Saatdichte bei Einlegegurken 74.000 bis 247.000 Korn/ha.
In diesem Spektrum nimmt der Ertrag mit der Dichte zu, die Qualität bleibt konstant (maximal 3 % übergroße Gurken). Wird dichter gesät, nimmt die vermarktbare Ernte durch geringer werdenden Anzahl von verwertbaren Gurken pro Pflanze um bis zur Hälfte ab.
Um mehr Effizienz ging es auch Touria El-Jaoual, University of Massachusetts, bei Rosenkohl. Ihre Annahme: Die Röschen einzeln zu verkaufen, ist arbeitsintensiv und fördert Krankheiten. Warum nicht den ganzen Strunk vermarkten? Damit diese nicht zu lang wurden, führte man den bei der obersten Knospe einen Kulturschnitt durch, wenn die darunter folgenden Knospen einen Durchmesser von mindestens 2,5 cm hatten. Die Ergebnisse waren stark sortenabhängig, hatten aber eines gemein: Der Kulturschnitt wirkte sich negativ aus.
Das betraf sowohl Knospendichte als auch letztlich den Ertrag. Hinsichtlich der Krankheitsanfälligkeit stellte sich kein Effekt ein.
Bio: Keine Monokulturen
Ein Schwerpunkt im Bereich der biologischen Erzeugung lag auf der Diversifizierung der Produktpalette. Da in den USA meist im großen Stil biologisch angebaut wird, kommt es auf Grund der Monokulturen zu hohem Schädlingsdruck; zudem ist die Abhängigkeit der Produzenten von den schwankenden Preisen für eine einzige Art hoch. Außerdem ergeben sich Leerzeiten, in denen nichts verkauft werden kann.
Sajeemas Pasakdee und sein Team, Jordan College of Agricultural Sciences and Technology, Kalifornien, schlägt daher vor, im Winter verstärkt Kreuzblütler in die Fruchtfolge einzubauen. Diese könnten dann einerseits in den Boden eingearbeitet werden, um Schädlingen vorzubeugen. Anderseits können sie aber auch als Speise-, Öl- oder Futterpflanzen vermarktet werden.
Senf als Gurken-Vorfrucht
James DeDecker, Universität Illinois, wiederum unterstrich die Bedeutung der Winterfrüchte als Präventivmaßnahme, um Unkrautdruck (speziell zu Kulturbeginn) zu lindern. Als konkretes Beispiel präsentierte er eine Studie rund um Senf als Vorfrucht für Gurken.
Bio-Diesel im Gemüsebau?
Die stets wachsende Produktion von Bio-Treibstoffen könnte einen sehr erfreulichen Nebeneffekt für den Gemüsebau haben. Ein Seminar befasste sich mit dem Potenzial, Reststoffe von Produkten wie Bio-Diesel als Dünger zu verwenden.
Der Tenor: Obwohl noch einiges an Forschung notwendig ist, könnte dieser Ansatz den Grundstein eines nachhaltigen Recyclingkonzepts darstellen.
Diesem Bericht könnte man noch Zusammenfassungen der 250 weiteren Vorträge hinzufügen. Eines zeigten sie alle: Wer glaubt, dass im Gemüsebau schon alles erforscht ist, der hat weit gefehlt.
Nick Dokoozlian, E&J Gallo, sagte, dass der Druck aus den Schwellenländern auf Europa und die USA immer stärker werde. Dem könne man nur mit Qualität entgegenhalten – und diese erfordere eine enge Kooperation mit der Wissenschaft.
Veredlung bringt Qualität
Die am meisten in Vorträgen behandelte Gemüseart war die Tomate.
Charles Barrett, Universität Florida, stellte fest, dass Veredeln sich auch auf die Qualität nicht negativ auswirkt: Bei Säure, Vitamin C- und Lycopingehalt zeigten sich keine Unterschiede im Vergleich zu nicht veredelten Tomaten. Hinsichtlich Vitamin B wurden nur bei einigen Sorten minimale Beeinträchtigungen nachgewiesen. Damit scheint bestätigt, dass die ertragssteigernde Wirkung der Veredlung keine negativen Konsequenzen auf die wertvollsten Inhaltsstoffe der Tomate hat.
Paprika leicht schattieren
Juan Carlos Díaz-Pérez, University Georgia, präsentierte Ergebnisse eines Versuchs über die Auswirkung der Schattierung auf die Photosynthese-Leistung von Paprika. Die Annahme im Vorfeld war dabei, dass dadurch die Qualität der Früchte gesteigert und der Wasserbedarf gleichzeitig gesenkt werden könne. Das hatten vorige Experimente bereits gezeigt. Unsicher war allerdings die Konsequenz bei der Photosynthese-Leistung, die den Ertrag bestimmt. Das Resultat war, dass eine Schattierung von 30 % weniger Lichtintensität den Ertrag nicht beeinträchtigt, jedoch Blatttemperatur und -wachstum senkt, was sich wiederum positiv auf Qualität, Wasser- und Nährstoffbedarf auswirkt.
Einlegegurken nicht zu dicht
Effizienzsteigerung war ein weiterer Fokus, den viele Referenten in den Mittelpunkt stellten.
Jonathan R. Schultheis, Universität von North Carolina State, empfiehlt als optimale Saatdichte bei Einlegegurken 74.000 bis 247.000 Korn/ha.
In diesem Spektrum nimmt der Ertrag mit der Dichte zu, die Qualität bleibt konstant (maximal 3 % übergroße Gurken). Wird dichter gesät, nimmt die vermarktbare Ernte durch geringer werdenden Anzahl von verwertbaren Gurken pro Pflanze um bis zur Hälfte ab.
Um mehr Effizienz ging es auch Touria El-Jaoual, University of Massachusetts, bei Rosenkohl. Ihre Annahme: Die Röschen einzeln zu verkaufen, ist arbeitsintensiv und fördert Krankheiten. Warum nicht den ganzen Strunk vermarkten? Damit diese nicht zu lang wurden, führte man den bei der obersten Knospe einen Kulturschnitt durch, wenn die darunter folgenden Knospen einen Durchmesser von mindestens 2,5 cm hatten. Die Ergebnisse waren stark sortenabhängig, hatten aber eines gemein: Der Kulturschnitt wirkte sich negativ aus.
Das betraf sowohl Knospendichte als auch letztlich den Ertrag. Hinsichtlich der Krankheitsanfälligkeit stellte sich kein Effekt ein.
Bio: Keine Monokulturen
Ein Schwerpunkt im Bereich der biologischen Erzeugung lag auf der Diversifizierung der Produktpalette. Da in den USA meist im großen Stil biologisch angebaut wird, kommt es auf Grund der Monokulturen zu hohem Schädlingsdruck; zudem ist die Abhängigkeit der Produzenten von den schwankenden Preisen für eine einzige Art hoch. Außerdem ergeben sich Leerzeiten, in denen nichts verkauft werden kann.
Sajeemas Pasakdee und sein Team, Jordan College of Agricultural Sciences and Technology, Kalifornien, schlägt daher vor, im Winter verstärkt Kreuzblütler in die Fruchtfolge einzubauen. Diese könnten dann einerseits in den Boden eingearbeitet werden, um Schädlingen vorzubeugen. Anderseits können sie aber auch als Speise-, Öl- oder Futterpflanzen vermarktet werden.
Senf als Gurken-Vorfrucht
James DeDecker, Universität Illinois, wiederum unterstrich die Bedeutung der Winterfrüchte als Präventivmaßnahme, um Unkrautdruck (speziell zu Kulturbeginn) zu lindern. Als konkretes Beispiel präsentierte er eine Studie rund um Senf als Vorfrucht für Gurken.
Bio-Diesel im Gemüsebau?
Die stets wachsende Produktion von Bio-Treibstoffen könnte einen sehr erfreulichen Nebeneffekt für den Gemüsebau haben. Ein Seminar befasste sich mit dem Potenzial, Reststoffe von Produkten wie Bio-Diesel als Dünger zu verwenden.
Der Tenor: Obwohl noch einiges an Forschung notwendig ist, könnte dieser Ansatz den Grundstein eines nachhaltigen Recyclingkonzepts darstellen.
Diesem Bericht könnte man noch Zusammenfassungen der 250 weiteren Vorträge hinzufügen. Eines zeigten sie alle: Wer glaubt, dass im Gemüsebau schon alles erforscht ist, der hat weit gefehlt.
NEU
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Normal
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen