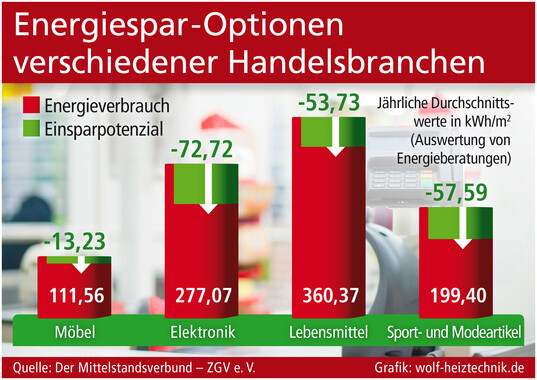Regionale Landwirtschaft zwischen Welternährung und Klimaschutz
Zur Eröffnung des „Tag des offenen Hofes“ auf dem Bauernhof der Familie Löding in Buchholz, Schleswig-Holstein, diskutierten Vertreter aus Politik, Verbänden und Praxis mit Blick auf den Krieg in der Ukraine über regionale Landwirtschaft zwischen Welternährung und Klimaschutz und eine mögliche Zeitenwende in der Agrarpolitik.
- Veröffentlicht am

„Die Ukraine ernährt in Friedenszeiten rund 400 Mio. Menschen. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass es jetzt bei uns nicht um Flächenstilllegung sondern eher um mehr Anbauflächen gehen sollte“, fragte die NDR-Moderatorin Harriet Heise in die Runde.
Für 2023 könnte laut dem Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied ein großer Teil der vorgesehenen nicht produktiven Fläche für die Getreideerzeugung genutzt werden, um die Versorgungslage zu entspannen. Dieses Angebot der Bauern müsse die Politik annehmen. Die Weiterentwicklung der Landwirtschaft hin zu noch mehr Klimaschutz, Umweltschutz und Tierwohl müsse weiterhin auf der Agenda stehen, eine weitere Ökologisierung der Landwirtschaft sieht er jedoch kaum als Lösung. „Wir stehen vor einem Transformationsprozess“, so Rukwiek, der auf die Gefahr hinwies, die inländische Produktion ohne ausreichende Fördermittel zu verlagern. Rukwied sprach von rückgängigen Direktvermarktung.
Im Umbrechen der ökologischen Vorrangflächen sieht Dr. Manuela Rottmann, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, keinen guten Weg, denn das hieße Feuer mit Benzin zu löschen und den Klimawandel mit seinen negativen Folgen voran zu treiben. Die langfristige Sicherung der Ernährung werde künftig nur ressourcenschonender und im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundladen wirtschaftlich gelingen können. Ihr gehe es jetzt vor allem darum, die Handelswege offen zu halten und zu einem insgesamt stabileren System zu kommen. Man müsse die Selbstversorgung, bei der kleine, regionale Betriebe eine Schlüsselrolle übernehmen, gerade auch in den armen Ländern verbessern.
Das große Ganze sehen
Auf das eher vorhandene Verteilungs- als auf das Mengenproblem in der internationalen Weltwirtschaft wies Dr. Dorit Kuhnt, Staatssekretärin im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein hin. „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Mit 4 % Ackerrandstreifen lässt sich die Welternährung nicht sicher“, sie appellierte, nicht eine Krise gegen die andere auszuspielen. Es gehe außer um die Ernährungskrise auch um die Klima- sowie die Artenkrise gleichermaßen. Zielführend sieht sie beispielsweise die in Schleswig-Holstein auf den Weg gebrachte Biodiversitätsstrategie.
Die Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend Theresa Schmidt betonte, dass Landwirtschaft regional sei und globale Verantwortung übernehmen muss. Doch dafür benötige es gesellschaftliche Akzeptanz, Planungssicherheit und politische Verankerung. Nur so bietet die heimische Landwirtschaft auch nachfolgenden Generationen eine Chance. Sie sieht den Handel als Politiktreiber, „wir müssen weg von Billigimporten hin zu mehr regionalen Lebensmitteln, die Zeit rennt“, sagte sie.
Die Macht des Handels
Die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes Petra Bentkämper betonte die Bedeutung der regionalen Produktion. „Wenn ein Betrieb erst einmal aufgegeben hat, ist dieser unwiederbringlich verloren“, warnte sie und sieht einen großen Hebel bei der Gemeinschaftsverpflegung. Von der Politik fordert sie bundesweit angeglichene Vergaberichtlinien, die es den öffentlichen Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung erleichtert, regionale Lebensmittel zu verarbeiten.
Der Forderung einer Nachfragesteigerung stimmte Kuhnt zu, wies aber gleichzeitig auf die Macht des Lebensmittelhandels hin. Auch der Gastgeber, Spargelproduzent und Direktvermarkter Andreas Löding, Lödings Bauernhof am See in Buchholz, wies auf die Macht staatlicher Lebensmitteleinkäufe für diverse Gemeinschaftsverpflegungen von Kindergärten über Schulen bis hin zu Großveranstaltungen hin, die sich auf regionale Güter beschränken sollte. Das würde nicht nur einen Nachfrageschub geben, sondern gleichzeitig die Logistik für Direktvermarkter fördern.
Löding sieht die aktuelle Erhöhung des Mindestlohns nicht ohne Strukturwandel zu schaffen und es zeichnet sich bereits ab, dass Betriebe aufgeben müssen. Einen so enormen Lohnsprung hat seines Wissens noch kein Wirtschaftszweig seit der Nachkriegsszeit realisieren müssen. Bei 3 bis 6 € Mindestlöhnen in anderen EU-Ländern ist keine Wettbewerbsfähigkeit mehr gegeben. Ein Wegfall der Mehrwertsteuer auf heimische Produkte wie Spargel und Beeren würde die Lohnsteigerung ausgleichen. Der Direktvermarkter gilt als Vorzeigebetrieb. Trotzdem äußerte Löding Bedenken darüber, ob auch in zehn Jahren noch eine wirtschaftliche Betriebsführung mögliche ist. Die Handelsketten bestimmen über die langfristige regionale Produktion. Statt vorgeschriebener Festpreise wünscht er sich besser Nachfragestützen von Seiten der Politik. Er sieht es kritisch, Flächen aus der Produktion zu nehmen. Gerade in Gunstregionen müsse jeder Betrieb dazu beitragen, die Versorgungslage zu entspannen, ohne dass die Umwelt nachhaltig darunter leidet.