Es kommt auf das Zusammenspiel mit dem Handel an
Ein exklusives Interview mit Prof. Dr. Ulrich Enneking, Professor für Agrarmarketing an der Hochschule Osnabrück, zu dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahr Obst und Gemüse 2021. Das Themenjahr soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die wichtige Rolle von Obst und Gemüse für die menschliche Ernährung, die Ernährungssicherheit und die Gesundheit sowie für das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele zu schärfen. Durch Aktionen, Informationen und praktische Tipps soll die Lust der Menschen auf diese wertvolle Lebensmittelgruppe wachsen und gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung sinken.
- Veröffentlicht am
GEMÜSE: Die Vereinten Nationen erklären das Jahr 2021 zum „Internationalen Jahr Obst und Gemüse“. Durch Aktionen, Informationen und praktische Tipps soll die Lust der Menschen auf diese wertvolle Lebensmittelgruppe wachsen und gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung sinken. Denn Obst und Gemüse machen mehr als ein Drittel des gesamten Lebensmittelabfalls in Deutschland aus. Wie beurteilen Sie diese Aktion?
Prof. Dr. Ulrich Enneking: Ohne die Details zu kennen denke ich, dass dies eine grundsätzlich gute Idee ist. Die Ernährung mit Obst und Gemüse bietet viele gesundheitliche Vorteile. Außerdem wirkt sich diese Ernährungsform positiv auf den Klimawandel aus. Pro Flächeneinheit lassen sich mit Gemüse höhere Erträge und Nährstoffe erzielen im Vergleich zu Getreideanbau oder Tierzucht. Im Vergleich mit Getreide wird bei der Produktion von Gemüse viel mehr Biomasse für Nahrungsmittel verwendet.
Also insgesamt sehe ich in der Aktion eine sehr positive Grundidee. Nun kommt es auf die Umsetzung an. Ein ganz wichtiger Player hier ist der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und es kommt darauf an, in wieweit sich dieser der Kampagne anschließt.
GEMÜSE: Kommt diese Aktion zu Corona-Zeiten gerade richtig?
Prof. Enneking: Eine spannende Frage. Nebenbei gesagt, führen wir dazu gerade ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördertes Forschungsprojekt durch, in dem es um Lebensmittelverschwendung und die Frage der Vermeidung geht. In diesem Kontext haben wir gerade eine aktuelle Umfrage am Laufen, aus der sich bereits gewisse Trends wie vermehrte Wochenmarkt- und Direktverkäufe durch Corona absehen lassen. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es allerdings leicht gegenläufige Effekte, da viele aus Angst vor Ansteckung ihre Einkäufe reduzierten. Auch wurde vermehrt wieder nach Plastikverpackungen gefragt.
Insgesamt sehen wir, dass sich Veränderungen im Lebensmitteleinkauf stark in Grenzen halten. Es gibt zwar Impulse, die aber mittelfristig nur zu geringen Gesamtänderungen führen. Ich meine, dass alles mit der Corona-Krise in Verbindung stehende wie die gestärkte Online-Vermarktung als zusätzlicher Impuls in der Vermarktung genutzt werden kann, um Verbraucher etwas leichter zu sensibilisieren und einen besseren Start für eine Vermarktungsform hinzubekomme. Als zusätzlicher Impuls kann Corona für eine Kampagne wie diese also vielleicht nützlich sein, da die Menschen insgesamt sensibler sind. Aber Corona wird mittelfristig für den Absatz von Gemüse kaum eine Rolle spielen. Da stehen andere Themen mit langfristigen Trends wie Klima oder gesunde Ernährung im Vordergrund.
GEMÜSE: Obst und Gemüse machen mehr als ein Drittel des gesamten Lebensmittelabfalls in Deutschland aus Was schätzen Sie: Wieviel Lebensmittelverluste lassen sich durch so eine Aktion verhindern?
Prof. Enneking: Ich verstehe diese Aktion als einen Impuls, um an verschiedenen Stellen etwas anzuschieben. Ich glaube nicht, dass diese von einem Ministerium begleite Aktion allein viel bewirken kann. Es kommt darauf an, dass Verbraucherverbände und weitere Gruppen diese Aktion auf den sozialen Medien verbreiten.
Die Kampagne kann nur dann eine Wirkung erzeugen, wenn sie und vielleicht auch die öffentliche Diskussion Einfluss nimmt auf die zentralen Akteure, die Erzeuger und Handelsketten bis hin zum LEH. Diese Akteure spielen die entscheidende Rolle. Ich bin skeptisch, dass sich das Verbraucherverhalten so schnell ändern lässt. Das wird ein längerfristiger Prozess werden, durch den von den 30 % Lebensmittelverschwendung sich nur 3 bis 5 % reduzieren lassen.
GEMÜSE: Werden die Menschen durch diese Aktion tatsächlich mehr Obst und Gemüse verzehren? In welcher Größenordnung?
Prof. Enneking: Es wird hier ähnlich sein und lediglich einen Trend geben, mehr zu verzehren. Dieser Trend wird sich langsam entwickeln und zielgruppenspezifisch unterschiedlich ausfallen. Einige werden ihre Verzehrgewohnheiten nicht ändern, andere etwas mehr, so dass die Mengenänderungen insgesamt erst einmal klein bleiben werden. Es wird aber einen allmählichen Trend geben, mehr Obst und Gemüse zu essen, da bin ich überzeugt.
Der Markt wird multifaktoriell beeinflusst. So eine Kampagne kann, je mehr sie auf die Vermarktungskette einwirkt und je mehr sich der Handel dahinterklemmt, durchaus einen Beitrag leisten. Der Handel kann seine Obst- und Gemüseabteilungen optimieren, die Produkte besser präsentieren und stärker bewerben. Ich würde so eine Kampagne nicht kleinreden, aber man kann nicht erwarten, dass durch sie allein viel bewirkt wird. Es kommt vielmehr auf das gute Zusammenspiel aller Akteure an. Die Kampagne selbst ist nur eine von vielen Einflussfaktoren.
GEMÜSE: Wie, in welcher Form lässt sich so eine Aktion der Öffentlichkeit am wirkungsvollsten präsentieren?
Prof. Enneking: Hier haben wir das Problem, dass so eine Bekanntmachung in der Öffentlichkeit mit Werbung bezahlt werden müsste, aber selbst ein Ministerium kann nicht allzu viel Geld in Werbung stecken. Unbedingt sollten die Sozialen Medien einbezogen werden. Man müsste insbesondere bei Multiplikatoren ansetzen, also zum Beispiel in Kochshows diese Aktion platzieren, nämlich genau dort, wo Menschen Ernährungsfragen diskutieren und dafür offen sind. Lohnen würde es zudem, Influencer als Multiplikatoren zu motivieren. Insbesondere jüngere, aktive Menschen fragen zunehmend nach dem Sinn hinter so einer Kampagne. Diese Menschen sollten auch emotional durch solche, vergleichsweise kostengünstigen Formate erreicht werden.
Weiterhin lohnt die Überlegung, welche Hebel in der herkömmlichen Lieferkette zu nutzen sind.
GEMÜSE: Bisher ist die Aktion unter Verbrauchern noch recht unbekannt. Welche Marketingaktivitäten würden Sie direkt absetzenden Gemüseproduzenten sowie Absatzorganisationen empfehlen, um von dieser Aktion zu profitieren?
Prof. Enneking: Diese können den Vorteil der von höherer Ebene angeschobenen Aktion unmittelbar nutzen, denn sie gibt der Lieferkette sozusagen einen Segen von oben. Ich würde versuchen, genau dies bestmöglich auszunutzen mit dem Wissen im Hintergrund, dass Menschen etwas Sinnvolles tun und essen möchten. Auf dieser Werte- oder Gesundheitsebene lohnt es sich, anzusetzen. Diese Aktion lässt sich für die Imagebildung stark nutzen und sicher auch durch ein aussagekräftiges Logo gut abbilden.
Wichtig ist eine Bündelung der Aktivitäten, um nicht im allgemeinen Rauschen unterzugehen. So sollten sich die Verbände zusammentun und einheitlich kommunizieren.
GEMÜSE: Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE), ein interdisziplinär besetztes Gremium, welches das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bei der Entwicklung seiner Politik ehrenamtlich berät, übergab ein Gutachten „Eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten“ an die Bundesministerin Julia Klöckner. Darin formuliert der WBAE neun zentrale Empfehlungen für die Transformation des Ernährungssystems, welche sich an den vier zentralen Zieldimensionen einer nachhaltigeren Ernährung orientiert, den sogenannten „Big Four“: Gesundheit, Soziales, Umwelt und Tierwohl. Was können Gemüseproduzenten daraus ableiten? Wie können diese davon profitieren?
Prof. Enneking: Gemüseproduzenten haben den Riesenvorteil, automatisch schon einige der „Big Fours“ in ihre Produkte integriert zu haben. Wenn ich mich mit Gemüse satt esse, stehen weniger Schlachttiere im Hintergrund und ich habe Gutes für meine Gesundheit getan. Die Chance liegt darin, dies als Steilvorlage in das Marketing zu integrieren. Genau wie die Aktion ist dieses Gutachten eine sehr gut nutzbare Steilvorlage.
GEMÜSE: Werden unter Ihrer Leitung derzeit den Gemüsebau betreffende Projekte durchgeführt?
Prof. Enneking: Ja, in einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt geht es darum, interdisziplinär zusammen mit einem großen Lebensmittelhändler, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und mit Produzenten neue Wege auszuprobieren. Konkret geht es darum, nach bisherigen Regelungen nicht marktfähige oder nicht handelsübliche Gemüseprodukte, die beispielsweise nicht den Handelsklassen oder den Konventionen im LEH entsprechen, marktfähig zu machen. Obwohl diese Produkte teils nachhaltiger sind, weil sie beispielsweise weniger Dünger in der Produktion verbrauchten, werden sie bisher nicht verkauft. Teils wird kurz vor der Ernte noch gedüngt, um ein bestimmtes Erntegewicht zu erreichen. Würde man kleinere Produktgrößen akzeptieren, was bei zunehmend kleineren Haushalten sogar erwünscht ist, ließe sich Dünger einsparen und Verschwendung in Form von zu viel Abfällen vermeiden.
Ein weiteres Projekt, an dem ich lediglich beteiligt bin, befasst sich mit hohlstrunkfreiem Brokkoli. Über Züchtung, Pflanzenernährung und Verbraucherakzeptanz soll ein Konzept erarbeitet werden, um kleineren, hohlstrunkfreien Brokkoli anbieten zu können. Mein Part liegt in der Verbraucherforschung.
Die Fragen stellte Dr. Gisela Fischer-Klüver.
Prof. Dr. Ulrich Enneking hat seit 2006 eine Professur für Agrarmarketing an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück. Im Mittelpunkt der aktuellen Forschungsaktivitäten stehen die Quantifizierung des Einflusses von als nachhaltig und/oder zukunftsorientiert postulierten Produktcharakteristika, die Erklärung des Käuferverhaltens mit Hilfe marketingpsychologischer und -soziologischer Theorieansätze wie Lebensstilkonzepten, die Analyse des Shopperverhaltens im LEH und im gärtnerischen Einzelhandel und die experimentelle und quasi-experimentelle Analyse von Kaufentscheidungen in möglichst realitätsnahen Entscheidungssituationen. Neuere Produktmerkmale werden dabei zusammen mit klassischen "Präferenztreibern" wie dem Geschmack bewertet und durch lebensmittelsensorische Studien und Verbraucherbeobachtungen, zum Beispiel in Form von Blickaufzeichnungen (Eye Tracking), untersucht.
Weitere Forschungs- und Transferschwerpunkte liegen in der Erarbeitung und Bewertung von Marketingkonzepten und von marketingbezogenen Prozessen wie das Innovationsmanagement in mittelständischen Unternehmen. Branchen- und Produktschwerpunkte liegen im Bereich der verarbeiteten und verpackten Lebensmittel, im gärtnerischen Einzelhandel und in der Agrartechnik (B2B-Marketing).



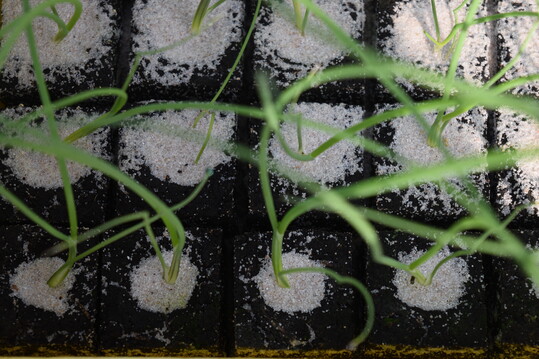


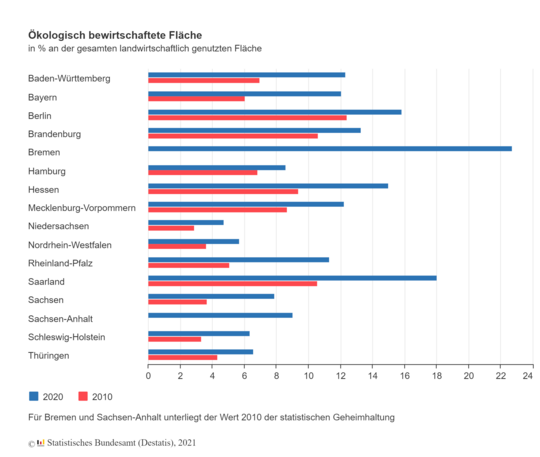



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.