Neue Wege für Metropolregionen schaffen
Interview mit Prof. Dr. Andreas Ulbrich, Professor für Gemüseproduktion und Verarbeitung sowie Studiengangssprecher „Bioverfahrenstechnik in Agrar- und Lebensmittelwirtschaft“ an der Hochschule (HS) Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur. Ulbrich ist zudem Leiter der AG „Growing Knowledge“, aus der heraus die Idee für das neue Forschungszentrum entstand.
- Veröffentlicht am

GEMÜSE: Herr Prof. Ulbrich, die Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur steht zunehmend für die Entwicklung, Erforschung und Vermittlung von Agrarsystemen der Zukunft. Kommt da der konventionelle Gemüsebau nicht zu kurz? Sowohl bei der Ausbildung wie auch der Forschung?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Eine sehr gute Frage, aber ich meine, nein. Wir wollen für Metropolregionen dieser Welt neue Wege schaffen, den immer stärker werdenden Anforderungen regionaler, pflanzlicher Nahrungsmittel in besonderen, neu zu entwickelnden Kulturräumen und –systemen Rechnung zu tragen. Da werden wir Kulturräume nutzen, die ergänzend zu den klassischen Feld- und Gewächshausgemüsekulturen zu positionieren sein werden.
Ganz wichtig: Es soll hierbei nicht um eine Konkurrenz, sondern eine Erweiterung des gärtnerischen Handelns werden. Es soll eine Chance werden für den Gartenbau, sich den aktuellen, wichtigen Fragestellungen der Gesellschaftsentwicklung, der Konsumerwartungen zu stellen. Wir sehen eine große Chance für den Gartenbau, auch in Metropolregionen tatsächlich präsenter zu agieren. Damit wollen wir auch eine Brücke schlagen hin zum klassischen Gartenbau, um diesen in ein besseres Licht zu rücken. Die Verbraucher sollen durch die urbane Gemüseproduktion besser verstehen, was dahinter steht. Wir denken weiterhin an den klassischen Gartenbau, der seine bedeutende Rolle behält.
GEMÜSE: Die für die Forschung mit Gemüse ausgewählten Salate und Kräuter sowie Süßkartoffeln als „Energielieferant“ bilden ja nur einen Teil der Gemüsekulturen. Wo bleibt das Fruchtgemüse und wie sollen die großen Freilandkulturen wie Kohlgewächse, Möhren und so weiter zukünftig wohl Berücksichtigung finden?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Wir brauchen auch zukünftig die klassischen großen Feldgemüse-Areale. Die klassischen Kohlkulturen oder Möhren, die einfach auch einen gewissen Wurzelraum benötigen, werden wir nicht in Indoor-Vertical-Farmen integrieren können. Diese Kulturen bleiben weiterhin wichtig, aber es gibt eben ergänzende Produkte, die die Vielfalt des Gemüsebaus verstärken sollen. Zum Beispiel sind Süßkartoffeln im klassischen Feldgemüsebau bei uns nur sehr bedingt anbaubar. Die Fruchtgemüseproduzenten werden weiterhin in klassischer Form benötigt. Hier kann es lediglich sein, dass wir mit neuen Raum- und Kultursystemen ergänzend in diesen Farmen neue Produktionsmöglichkeiten schaffen werden. Aber das wird keinesfalls ein Ersatz für die klassische Fruchtgemüseproduktion werden.
Das verdeutlicht schon allein der geringe Selbstversorgungsgrad in Deutschland. Jeder Verbraucher nutzt 7 bis 8 kg Tomaten/Jahr, davon stammen nur rund 10 % aus deutscher Produktion.
GEMÜSE: Sind die für die Finanzierung genannten 4 Mio. € tatsächlich ausreichend für den Bau inklusive der Infrastruktur?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Originär waren es einmal 3 Mio. €, aber aufgrund der Planungsarbeiten und der Erkenntnis, dass wir noch nie dagewesene Systeme errichten werden, haben wird die Kostenschätzung bereits angehoben. Alle Bauvorhaben verteuern sich in Deutschland massiv Jahr für Jahr. Aus dem Grunde weiß natürlich final keiner, ob wir tatsächlich mit den 4 Mio. € auskommen. Aber nach aktuellem Finanzmanagement würden wir tatsächlich eine Punktlandung erreichen.
GEMÜSE: Wie ist die langfristige Finanzierung/Unterhaltung geplant? Rechnen Sie mit mehr Studenten und einer darauf aufbauenden Erhöhung der Jahresmittel von Seiten der Hochschule?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Die Hochschule hat zugesichert, für die nicht unerheblichen Verbrauchskosten der Farm aufzukommen. Kämpfen muss ich immer dann, wenn wir neue Forschungsinhalte dort platzieren möchten. Dann müssen wir uns um Drittmittelfinanzierung, Forschungsmittelanträge, bemühen. Das wird uns aber mithilfe unseres guten Netzwerkes, wie dem ZIM-Netzwerk AgrarCycle der HS Osnabrück zur Förderung der vertikalen Landwirtschaft, gelingen. Ich gehe davon aus, dass wir zusammen mit diesen teils auch Industrie-Partnern das Forschungssystem auf feine finanziell gute Basis stellen.
Bereits jetzt zeigt sich ein großes Interesse von Seiten der Studierenden, nicht nur aus Osnabrück, die mit in solchen neuen Forschungsrichtungen arbeiten wollen. Das macht Spaß und bestärkt mich, dass wir das Interesse an weiterentwickelnder Arbeit geweckt haben.
GEMÜSE: Wie konnte dieser Bau überhaupt realisiert werden in einer Umgebung der ständig gekürzten Forschungsmittel bei anderen Hochschulen?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Es gab einen vom Land ausgeschriebenen Aufruf, sich mit innovative Projekte zur Förderung der Forschungsinfrastruktur zu bewerben. Vor fast vier Jahren habe ich eine erste Innovationsskizze eingereicht, die gutachterlich bewertet wurde. Daraus folge die Aufforderung, einen ausführlichen Forschungsantrag zu stellen. Schließlich gab das Land seine Zustimmung zur Förderung dieses innovativen Ansatzes. Der Bewilligungsbescheid kam Anfang 2019. Andere Wege hätte ich nicht gesehen.
GEMÜSE: Sind in Zusammenhang mit dem Bau des Forschungszentrums zusätzliche Stellen zu besetzen?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Bislang leider nicht. Die Hochschule steht in einem Diskussionsprozess. Bisher wird es so sein, dass alle neu in dem Forschungsbereich tätigen MitarbeiterInnen über neu einzuwerbende Drittmittel finanziert werden müssen.
GEMÜSE: Wer wird in dem Kubus wohnen, um den geplanten Energiefluss zwischen Mensch und Pflanze zu untersuchen? Studenten? Mitarbeiter?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Richtig wohnen darf leider aufgrund der Vorschriften und Förderrichtlinien keiner. Es handelt sich um einen reinen Forschungsinfrastruktur-Bau. Das müssen wir fiktiv betrachten, indem Büros und Laborräume in den Bau platziert werden. Zusätzlich mit dem weiteren dort arbeitenden Personal sind genügend Menschen in dem Kubus zugegen, um die Interaktionen Pflanze – Mensch zu testen.
GEMÜSE: Sie führen bereits Projekte mit Partnern aus dem Gemüsebau durch. Wie kommt dieses innovative Forschungszentrum in der Gemüsebau-Praxis an?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Ich stehe mit einigen größeren Gemüseproduzenten in Kontakt, die die Entwicklung der neuen Kulturräume und -systeme auch inhaltlich sehr interessiert begleiten. Ich habe bereits mehrfach angeboten, dieses Gesamtprojekt auch einmal der Gemüsebau-Praxis ausführlich vorzustellen. Das ist mir aber wohl aufgrund des besonderen zurückliegenden Jahres unter Covid-19 nicht gelungen. Ich hoffe sehr, dass es bald die Möglichkeit geben wird, mich intensiv mit der Gartenbau- beziehungsweise der Gemüsebau-Praxis auszutauschen.
GEMÜSE: Welche Fragen und Forschungsfelder interessieren die Gemüsebaupraxis derzeit aus Ihrer Sicht am meisten?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Es gibt tatsächlich Anfragen von Gemüseproduzenten, die bereits vor zwei Jahren schon nach einer energetischen Berechnung und der benötigten Infrastruktur für Indoor-Gemüsefarmen fragten. Da weltweit jedoch kaum Daten zu solcher Art neuen Produktionssystemen zur Verfügung stehen, konnten wir lediglich eine grobe Kalkulation geben. Allein um der Praxis anhand belastbarer Daten für die Produktionskosten eine Kalkulationsgrundlage zu bieten, ist das Forschungshaus wichtig.
Ich werden von zahlreichen Gemüseproduzenten immer wieder nach neuen Ideen gefragt, um sich besser am Markt zu positionieren und die Verbraucher besser abzuholen. Ohne belastbare Daten gelingt es nur schwer, Gärtnern eine neue Kulturform zu vermitteln.
GEMÜSE: Wie sehen Sie die Zukunft des deutschen Gemüsebaus? Wird die Eigenproduktion/Inlandproduktion zunehmen oder werden die Importe aus Drittländern steigen?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Wir machen uns zwar große Sorgen über die Corona-Pandemie, aber sie hat auch ein Gutes. Die Menschen sind deutlich mehr sensibilisiert bezüglich der Herkunft und Sicherheit der Lebensmittel. Insbesondere auch die jüngeren Verbraucher interessieren sich wesentlich mehr über nachhaltige Produktion. Wenn wir die richtigen Antworten und gute neue Konzepte liefern, wird der Gemüsebau in Deutschland eine ganz wichtige Rolle spielen und gute Zukunftsaussichten haben.
GEMÜSE: Warum hat dieses Projekt so eine hohe politische Relevanz?
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Immer mehr Menschen wollen in Metropolregionen wohnen. Gleichzeitig präferieren sie regional produzierte Nahrungsmittel. Das stellt uns in Metropolregionen vor Herausforderungen, da das Land immer knapper wird. Immer mehr Menschen in Metropolregionen denken nachhaltiger, ganz besonders bei der pflanzlichen Nahrungsmittelproduktion wird neben Quantität mehr Qualität nachgefragt.
Mir ist es ganz wichtig, dass die gärtnerische Praxis sensibilisiert und offen wird für neue Themen wie diese neuen Kultursysteme. Ein Teil der großen Gemüseproduzenten ist es auf jeden Fall.
Wer mehr über „Growing Knowledge“, das neue Forschungszentrum und die Person Prof. Dr. Andreas Ulbrich erfahren möchte, dem sei dieser Podcast empfohlen:







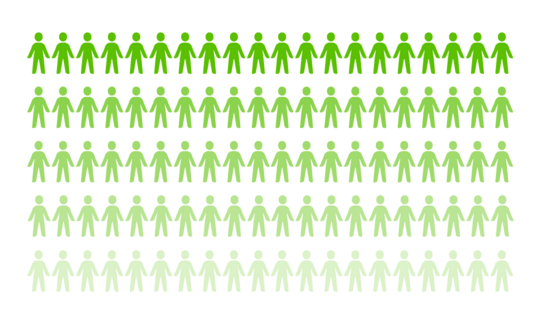
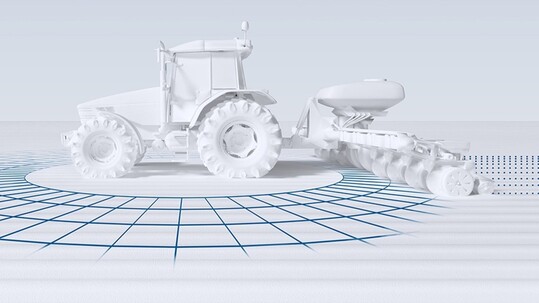

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.